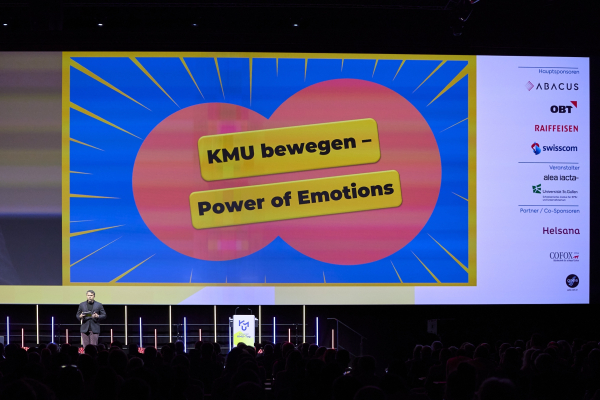HSG stellt globalen Benchmark für Unternehmenswertschöpfung vor

Text: PD/stz.
Der «Value Creation Ratings Report 2025» (VCr2025) der Universität St.Gallen und der Foundation for Value Creation bewertet erstmals 1000 börsennotierte Unternehmen weltweit und beleuchtet das Verhältnis zwischen geschaffenem Wert (Value Creation) und transferiertem Wert (Value Transfer). Der Bericht ist das Schwesterprojekt des ebenfalls an der Universität St.Gallen erstellten und bereits etablierten «Elite Quality Index» (EQx), der die nachhaltige Wertschöpfung von Nationen misst. Gemeinsam zeigen
VCr und EQx, dass nachhaltige Wertschöpfung eine ökonomisch fassbare Grösse ist, die zu wirtschaftlicher Entwicklung und allgemeinem Wohlstand führt.
Ausgewählte Ergebnisse des VCr2025
Nachhaltige Wertschöpfung ist messbar
Der VCr2025 zeigt, dass sich nachhaltige Wertschöpfung heute klar quantifizieren lässt – und offenbart überraschend grosse Unterschiede zwischen Branchen und Weltregionen. Diese Analyse basiert auf über 100 firmenspezifischen Kennzahlen, die ökonomische, soziale und ökologische Wertbeiträge integrieren und so ein neues Verständnis von Unternehmensleistung ermöglichen.
Globaler Vergleichsmassstab für nachhaltige Unternehmensleistung
Im Durchschnitt erreichen die analysierten Unternehmen einen VCr-Wert von 1.53 und eine Value Creation Position (VCp) von 78 Prozent – ein Hinweis auf solide, aber noch unausgeschöpfte Wertschöpfungspotenziale. Damit liefert der VCr eine datenbasierte Grundlage, um nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg über reine Finanzkennzahlen hinaus zu bewerten.
Automobilindustrie an der Spitze
Mit einem VCr von 1.63 führt die Automobilbranche das Ranking der Sektoren an, während Technologieunternehmen (1.50) auf Rang 5 liegen. Die klassischen Industrien zeigen damit, dass nachhaltige Wertschöpfung nicht allein von digitaler Skalierung abhängt, sondern auch von realwirtschaftlicher Transformation, Investitionen in grüne Technologien und industrieller Effizienz. Gleichzeitig offenbart die Technologiebranche strukturelle Herausforderungen: hohe Marktkonzentration, Dominanz einzelner Plattformen und wachsende Risiken einseitiger Wertverteilung bremsen ihr nachhaltiges Wertschöpfungspotenzial.
Apple als Beispiel für Exzellenz und die Ambivalenz nachhaltiger Wertschöpfung
Der Konzern erzielt einen Umsatz von 391 Milliarden US-Dollar, generiert jedoch einen gesamtwirtschaftlichen Wert von 396 Milliarden US-Dollar – also mehr Wert als Umsatz. Diese enorme Differenz verdeutlicht die aussergewöhnliche Wertschöpfungskraft des Unternehmens, zugleich aber auch die wachsende Marktmacht und systemische Bedeutung globaler Technologiekonzerne. Mit einem Value Transfer-OUT von 396 Milliarden US-Dollar gegenüber einem Transfer-IN von 198 Milliarden US-Dollar zeigt Apple, wie stark es Ressourcen, Talente und Aufmerksamkeit auf sich konzentriert – was einerseits Innovation und Wohlstand antreibt, andererseits aber auch Fragen nach Dominanz, Abhängigkeit und langfristigen Markt- und Gesellschaftsrisiken aufwirft. Apple steht damit sinnbildlich für die Ambivalenz nachhaltiger Wertschöpfung im digitalen Zeitalter.
Grosse Unterschiede zwischen Unternehmen verschiedener Länder
Die Streuung der VCr-Werte der Unternehmen aus 44 Ländern beträgt 0.34 – ein deutliches Signal für die enormen Unterschiede in der Qualität und Nachhaltigkeit der globalen Wertschöpfung. Spitzenreiter-Unternehmen aus der Schweiz, Deutschland und den nordischen Ländern profitieren von stabilen Institutionen, hoher Innovationskraft und klaren Governance-Strukturen. Unternehmen aus Ländern wie Indien, Brasilien oder Russland hingegen sind oft noch stark von extraktiven Geschäftsmodellen und institutionellen Schwächen geprägt. Diese Divergenz verdeutlicht, dass nachhaltige Wertschöpfung auf Unternehmensebene auch ein Spiegel der ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen eines Landes ist.
Auch interessant
Internationaler Wertschöpfungsstandard
Der Bericht etabliert das Value Creation Rating als neuen internationalen Wertschöpfungsmessungsstandard. «Mit dem VCr machen wir sichtbar, wie viel Wert Firmen wirklich schaffen – und wie viel sie ihren Stakeholdern nehmen. Nachhaltige Geschäftsmodelle sind jene, deren Wertschöpfung dauerhaft grösser ist als ihre Werttransfers», sagt Prof. Dr. Martin Nerlinger, Co-Director VCr Project und Assistenzprofessor für Finanzen an der Universität St.Gallen.
«Die Ergebnisse zeigen, dass die Entstehung von hochwertigen Arbeitsplätzen und Innovationen das bewusste Eingehen von Risiken erfordert. Risiko ist somit nicht lediglich ein Gegenstand des Controllings, sondern ein kreativer Prozess, der sich in der Wertschöpfung manifestiert», fasst Dr. Tomas Casas i Klett, Co-Director VCr Project, zusammen.
Hier gelangt man zum vollständigen Value Creation Ratings Report 2025 (VCr2025).