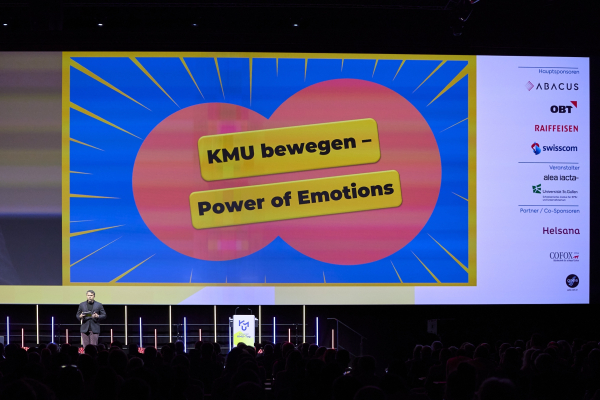Einkaufstourismus übersteigt Vor-Corona-Niveau

Text: PD/stz.
Die repräsentative Langzeitstudie beschreibt wesentliche Veränderungen im Konsumverhalten und legt in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf die Einführung der neuen Zollfreigrenze.
Die Studienautoren Thomas Rudolph, Nora Kralle und Tim-Florian Gerlach haben untersucht, welche Händler im Ausland bei Kunden in der Schweiz am beliebtesten sind und an welchen Orten sie am liebsten einkaufen. Seit 25 Jahren untersucht das Forschungsteam um Professor Thomas Rudolph am Institut für Handelsmanagement der Universität St.Gallen (IRM-HSG) den Einkaufstourismus in der Schweiz. Für die aktuelle Auflage der Studie in allen Sprachregionen der Schweiz wurden über 3000 Konsumenten befragt.
Schweizer Einkaufstouristen überschätzen die Preisvorteile im Ausland erheblich
Eine zentrale Erkenntnis: Gemäss der Analyse schätzen Schweizer Einkaufstouristen Waren in der Schweiz rund 66 Prozent teurer ein als im grenznahen Ausland. Der tatsächliche Preisunterschied in den fünf untersuchten Warengruppen liegt aber nur bei durchschnittlich 40 Prozent, was einer Überschätzung von 26 Prozentpunkten entspricht.
Massiv überschätzt werden die Preise in den Warengruppen Lebensmittel, Sportartikel und Einrichtungsgegenstände.
Weitere Ergebnisse im Überblick:
Motive: Die Hauptmotive für den Einkauf im Ausland sind in absteigender Reihenfolge: erstens tiefere Preise, zweitens Produkte, die es nicht in der Schweiz gibt, drittens die grössere Auswahl.
Städte: Das beliebteste Einkaufsziel der deutschsprachigen Schweizer bleibt Konstanz. Französisch- und italienischsprachige Schweizer fahren am liebsten nach Pontarlier und Como.
Lieferwege: 77 Prozent der Bestellungen im Ausland werden direkt in die Schweiz geliefert, der Rest im Ausland bei Freunden oder einem Postfach abgeholt.
Beliebte Händler im Ausland: Zwar haben die Bestellungen beim beliebtesten Onlinehändler Amazon zugenommen und auch Amazon Prime konnte zulegen, jedoch verzeichnete Temu das mit Abstand stärkste Wachstum.
Hemmnisse: In stationären Geschäften stellen überfüllte Züge, der hohe Kundenandrang sowie die aufwendige Zollabwicklung die grössten Hindernisse für den Einkaufstourismus dar.
Mehrwertsteuer-Rückerstattung: Mit der Reduktion der Zollfreigrenze von 300 auf 150 Franken lassen sich weniger Einkaufstouristen die Mehrwertsteuer zurückerstatten. Gleichzeitig hat sich die Nutzung der Tax-Free-Formulare erhöht.
Weitere Erkenntnisse:
Starke Verbreitung: 72 Prozent der Gesamtbevölkerung in der Schweiz fahren durchschnittlich 5,1-mal pro Jahr ins Ausland zum Einkaufen, legen dabei eine Fahrstrecke von rund 118 Kilometern zurück und geben im Durchschnitt in stationären Geschäften 230 Franken pro Einkauf im Ausland aus (188 Franken für Online-Einkäufe).
Leichte Zunahme des Einkaufstourismus: Die Einkäufe für Einrichtung, Lebensmittel, Sportartikel, Textilien und Drogerieartikel im Ausland erreichen im Jahr 2025 insgesamt 9,2 Milliarden Franken. Im Vergleich zum Jahr 2022 ist dies ein Anstieg um rund 10 Prozent. Damit erreicht der Einkaufstourismus 2025 das Niveau aus dem Jahr 2017, als er bei knapp 9,1 Milliarden Franken lag. Gemessen am Gesamtumsatz des Schweizer Detailhandels entsprechen diese 9,2 Milliarden Franken rund 9 Prozent aller Konsumausgaben. Der Online-Einkaufstourismus macht von den 9,2 Milliarden Franken (stationär und online) rund 1,6 Milliarden Franken aus und ist ebenso wie der stationäre Einkaufstourismus um rund 10 Prozent gewachsen.
Lebensmittel werden deutlich häufiger im Ausland eingekauft: Der Zuwachs des Einkaufstourismus um 10 Prozent geht fast ausschliesslich auf mehr stationäre Lebensmitteleinkäufe im benachbarten Ausland zurück. Diese Einkäufe für Lebensmittel haben um rund 800 Millionen auf neu 4,0 Milliarden Franken zugelegt. Der Umsatzverlust für den Schweizer Handel durch sowohl stationären als auch Online-Einkaufstourismus liegt für Einrichtung/Möbel bei 1,8 Milliarden, für Bekleidung bei 1,4 Milliarden, für Drogerieartikel bei 1,15 Milliarden und Sportartikel bei 730 Millionen.
Absenkung der Zollfreigrenze bremst das Wachstum: Konsumenten haben die Absenkung der Zollfreigrenze von 300 auf 150 Franken sowie die Einführung der Mehrwertsteuer für Online-Einkäufe auf ausländischen Marktplätzen wie Temu oder Shein wahrgenommen und erkennen darin eine Verteuerung von Einkäufen im Ausland. So kam es zwar bei Bekleidung und Sportartikeln noch zu einem kleinen Wachstum, für Möbel und Drogerieartikel hat sich der Einkaufstourismus jedoch leicht abgeschwächt.
Wachstum bei Lebensmitteln: Bei Lebensmitteln kam es zu einem massiven Wachstum des Einkaufstourismus, weil die Mehrwertsteuer-Rückerstattung in dieser Warengruppe bisher aus Konsumentensicht nicht wichtig war und der Einkaufsbetrag tiefer als in den anderen Warengruppen liegt. Die Absenkung der Zollfreigrenze hatte in dieser Warengruppe somit kaum Einfluss.
Inflation: Konsumenten haben die höhere Inflation im Ausland durchaus wahrgenommen und erkennen eine stärkere Annäherung der Preise zwischen der Schweiz und dem benachbarten Ausland. Dennoch kam es zu einem Anstieg des Einkaufstourismus. Die Autoren erklären diesen Zuwachs in erster Linie mit verstärkten Sparbemühungen. Viele Haushalte in der Schweiz zahlen für Energie und Krankenkasse mehr, sind verunsichert von der weltpolitischen Lage und den hohen Zöllen der USA. Diese historisch schlechte Konsumstimmung fördert den Einkaufstourismus trotz einer Verteuerung der Waren im benachbarten Ausland.
Die vollständige Studie «Einkaufstourismus Schweiz 2025» ist im Onlineshop des Instituts kostenfrei erhältlich.