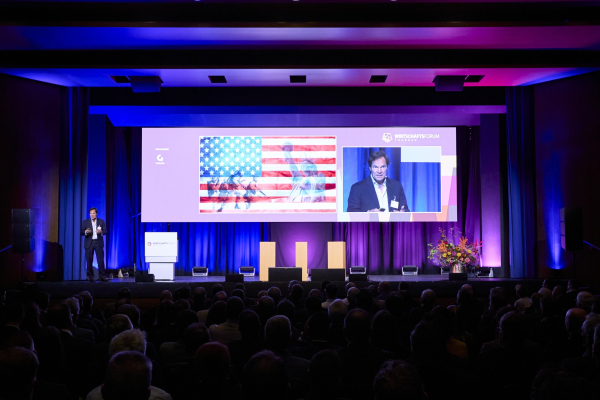Wirtschaftskriminellen auf den Fersen

Text: PD/stz.
Die Galerie zum Artikel finden Sie hier.
Betrug, Cyberangriffe, Korruption – immer wieder liest man von neuen Fällen von Wirtschaftskriminalität in der Presse. Das Thema ist aktueller denn je. Neben den medienwirksamen Fällen hat auch die zunehmende Professionalisierung der Täter die Wirtschaftskriminalität in den vergangenen Jahren stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt. «Organisationen müssen wissen, wie sie sich vor diesen Gefahren schützen können», sagt Prof. Dr. Marco Gehrig vom Kompetenzzentrum Accounting und Corporate Finance der OST in seiner Begrüssung zum 9. St.Galler Forum für Finanzmanagement und Controlling.
Mitarbeiter melden Verdachtsfälle
«Die Zusammenarbeit und der Dialog zwischen Management, Compliance und interner Revision sind zentral für die Verhinderung von Wirtschaftskriminalität», sagt Stephan Weiss, Chief Auditor bei Roche. Der Pharmakonzern deckt jedes Jahr grössere und kleinere Betrugsfälle auf. Diese reichen von Interessenkonflikten über Umsatzmanipulation bis Lieferantenbetrug, bei dem Lieferanten zum Beispiel gefälschte Rechnungen an Roche schicken.
Bei der Aufdeckung dieser Fälle spielen die 100'000 Mitarbeiter eine entscheidende Rolle. «Wir haben eine ‘Speak-up Line’ – eine Telefonnummer, bei der sich Mitarbeiter anonym melden können, wenn ihnen etwas Verdächtiges auffällt», erklärt Weiss. Die Verdachtsfälle werden bei Roche von zehn internen Ermittlern professionell untersucht.
«Ein signifikanter Teil der Fälle bestätigt sich», betont Weiss. Laut ihm ist es wichtig, dass diese Betrugsfälle Konsequenzen haben und Massnahmen gegen die entsprechenden Mitarbeiter durchgesetzt werden. Fundamental zur Verhinderung von Wirtschaftsstraftaten sei auch eine gelebte Compliance-Kultur, die von der Führungsebene vorgegeben wird.
Hochkonjunktur der Cyber-Wirtschaftskriminalität
Laut Weiss ist die Cybersicherheit bei Roche in den letzten Jahren in den Fokus gerückt. Die Kriminalstatistik des Bundes vom letzten Jahr zeigt die zunehmende Bedeutung des Themas auf: Mittlerweile macht Cyber-Wirtschaftskriminalität zehn Prozent aller registrierten Straftaten aus.
Die Relevanz von Cybersicherheit zeigte sich auch im Programm des 9. St.Galler Forums für Finanzmanagement und Controlling. Die 160 Teilnehmer hatten die Möglichkeit, sieben Workshops zu besuchen, unter anderem zu den Themen Cybersicherheit und KI.
Ohne Geldwäscherei keine Wirtschaftsdelikte?
Die zunehmende Digitalisierung und neue Finanztechnologien stellen auch die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) vor Herausforderungen. Die MROS leistet einen entscheidenden Beitrag zur Prävention und Aufdeckung von Geldwäscherei. Die Behörde ist dem Bundesamt für Polizei (fedpol) angegliedert. Geld, das aus der Wirtschaftskriminalität stammt, kann heutzutage innerhalb von Sekunden um die Welt geschickt werden.
«We follow the money», bringt es Marc Schröder auf den Punkt. Er ist Senior Policy Experte bei der MROS und leitet die Fachgruppe Wirtschaftskriminalität. An der OST ist er als Lehrbeauftragter tätig. «Wir nehmen Verdachtsmeldungen entgegen, prüfen diese und reichern sie mit mehr Informationen an. Erhärtet sich ein Verdacht, informieren wir die Strafverfolgungsbehörden», erklärt Schröder. Im Jahr 2024 hat die MROS über 1500 solche Meldungen geprüft.
Um Geld aus Straftaten im legalen Finanzkreislauf zu verwenden, muss es gewaschen werden. Für Schröder ist die logische Konsequenz, dass «es keine Wirtschaftskriminalität mehr geben würde, wenn Geldwäscherei konsequent aufgedeckt und das Geld eingezogen wird». Dafür spielen die Finanzintermediäre wie Banken und Versicherungen die wichtigste Rolle: «Sie haben den direkten Kontakt mit Kunden und müssen ihre Sorgfalts- und Meldepflicht wahrnehmen.»
Auch interessant
Der typische Weisskragenkriminelle
Doch könnte man Wirtschaftskriminelle nicht bereits im Unternehmen erkennen und ihre Verbrechen so verhindern? Mit dieser Frage beschäftigt sich Dr. Thomas Knecht. Er ist Facharzt für Psychiatrie im Psychiatrischen Zentrum Appenzell Ausserrhoden. «Bei Wirtschaftskriminellen spricht man auch von sogenannten Weisskragenkriminellen – im Englischen White-Collar-Crime.
Der weisse Kragen steht für die angesehene Position im Unternehmen – im Unterschied zum blauen Kragen der Arbeiter», erklärt Knecht. Eine neue Studie der KPMG bestätigt dieses jahrzehntealte Bild: Der typische Wirtschaftskriminelle ist demnach männlich, zwischen 36 und 55 Jahre alt, arbeitet seit einigen Jahren im Unternehmen und gilt als Respektsperson.
Narzisstisch und sozial intelligent
Laut Knecht weisen typische Wirtschaftskriminelle narzisstische Züge auf. Dies zeigt sich zum Beispiel durch Grössengefühle, einen Mangel an Empathie und eine unbegründete Anspruchshaltung. Dazu kommt häufig eine hohe soziale Intelligenz. Diesen Personen fällt es leicht, andere von sich zu überzeugen und sie zu ihrem Vorteil zu manipulieren. Die Frage stellt sich, wie solche Personen überhaupt in Kaderpositionen gelangen.
«Die Merkmale, die es für Führungspositionen braucht, überschneiden sich teilweise mit den genannten Persönlichkeitseigenschaften», zeigt Knecht auf. Hinzu kommt laut Knecht, dass Wirtschaftskriminelle oft charismatisch sind und eine Fassade der Freundlichkeit oder sogar Wohltätigkeit aufbauen. Ihre Motive sind unterschiedlich: «Sie handeln oft aus Gier nach noch mehr Gewinn oder weil sie ihren verschwenderischen Lebensstil finanzieren müssen», erklärt Knecht.
Familienunternehmen weniger anfällig
Laut Knecht ist es schwierig, Wirtschaftskriminelle anhand dieser Merkmale zu erkennen: «Auch wenn bereits bei der Rekrutierung Abklärungen auf solche Persönlichkeitsstörungen durchgeführt werden, wissen die Betroffenen oft, wie sie die Tests austricksen können.» Besonders Grossunternehmen, in denen Anonymität, Fluktuation und kurzfristige Gewinnziele herrschen, sind anfällig für wirtschaftskriminelle Aktivitäten.
«Das System liefert die Chancen, das Individuum nutzt sie aus», erläutert Knecht. Anders sieht es laut Knecht in Familienunternehmen aus: «Der Profit ist gemeinsam erwirtschaftet, und die Verwandtschaft hat einen schützenden Effekt gegen solche Machenschaften.»
Das nächste St.Galler Forum für Finanzmanagement und Controlling des Instituts für Finance und Law der OST findet am 14. August 2026 statt.