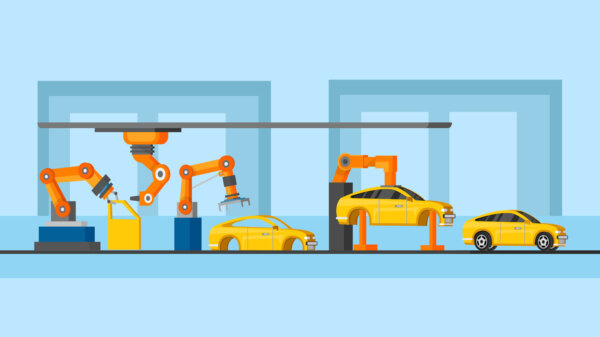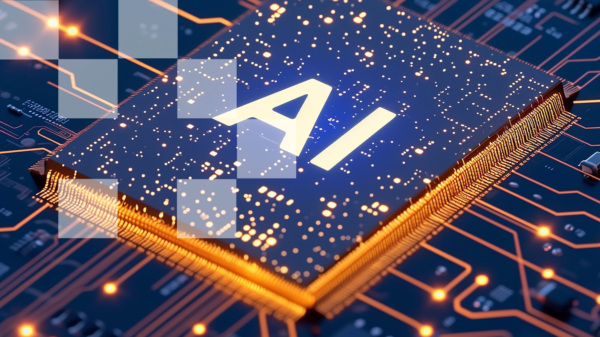Tüfteln an der Zukunft der Landwirtschaft

Die Mechanisierung hat im 19. und 20. Jahrhundert die Landwirtschaft und damit auch die Gesellschaft völlig umgekrempelt. Weniger Menschen konnten mehr Nahrungsmittel produzieren. Digitalisierung, Robotik und Künstliche Intelligenz werden erneut zu Technologiesprüngen in der Landwirtschaft führen – oder haben es bereits, wenn man etwa an Melkroboter denkt, die ihre Arbeit selbstständig erledigen können.
Oft allerdings ist die Lücke zwischen dem, was mit heutiger Technik theoretisch funktionieren sollte, und dem, was in der Praxis realisierbar ist, noch ziemlich gross. Solche Lücken zu schliessen, ist eine Aufgabe der angewandten Wissenschaft, wie sie an der Fachhochschule OST betrieben wird.
Im thurgauischen Tänikon zwischen Aadorf und Ettenhausen hat die OST seit einem Jahr eine Aussenstelle. Dass das neue Institut für intelligente Systeme und Smart Farming hier angesiedelt wurde, ist kein Zufall: Tänikon ist ein eigentlicher Hotspot für landwirtschaftliche Forschung. Hier ist auch Agroscope, das Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung, tätig; hier führt die Swiss Future Farm Versuche durch; hier hat das Landwirtschaftliche Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg des Kantons Thurgau einen Ableger. Und: Der Kanton Thurgau hat die Ansiedlung eines Instituts der einzigen Ostschweizer Fachhochschule auf Thurgauer Boden mit einer Grundfinanzierung gefördert.
Die ganze OST als Ressource
Den Wunsch nach einer systematischen Forschung im Bereich der Agrartechnologien gibt es schon länger als die OST. Jürgen Prenzler hat als Institutsleiter am damaligen NTB in Buchs die Entwicklung mechatronischer Systeme betreut und darauf gedrängt, mehr im Bereich Landwirtschaft zu machen – er war früher auch bei einem Landmaschinenhersteller in der Produktentwicklung tätig.
Unabhängig davon hatte Dejan Šeatović seit 2018 an der Fachhochschule Rapperswil zusammen mit Agroscope geforscht. Beide Fachhochschulen sind heute Teil der OST. Jürgen Prenzler ist pensioniert, Professor Dejan Šeatović ist Leiter des Instituts für intelligente Systeme und Smart Farming (ISF) in Tänikon. Das Team der OST in Tänikon besteht aktuell aus neun Personen, vor allem jungen Forschern. Das ISF ist innerhalb der OST dem Bereich Systemtechnik und Mechatronik angegliedert. Wenn Fragen zu Elektrotechnik, Energie oder Umwelt auftauchen, kann das ISF auch auf Expertise und Ressourcen weiterer Institute zurückgreifen, um schneller zum Ziel zu kommen.
Viele Forschungsfelder
Alle zwei bis drei Monate treffen sich die verschiedenen Player in Tänikon zu einer Forschungsratssitzung. «Da synchronisieren wir unsere Forschungsvorhaben», sagt Dejan Šeatović. Wenn es um eher technische Fragen geht, ist das Institut der OST stärker beteiligt; wenn es um agrarwirtschaftliches Wissen oder andere Fragen geht, kümmern sich Swiss Future Farm, Arenenberg oder Agroscope um ein Thema. «Unsere Kompetenz ist Technik», betont Dejan Šeatović. «Wie können wir Menschen von anstrengenden oder stressigen Aufgaben entlasten? Dieser Teil des Themas Farming wurde noch viel zu wenig beachtet.»
Im Auge haben die OST-Forscher dabei nicht zuletzt die Bürokratie, die Landwirte stresst. «Berichte schreibt niemand gerne, schon gar nicht nach einem langen Arbeitstag», sagt Dejan Šeatović. Deshalb möchte sein Institut im kommenden Jahr aufzeigen, wie ein Landwirt mit seinem Traktor kommunizieren kann. «Wenn der Traktor im Einsatz war, kann er auch gleich eine Dokumentation für das Bundesamt für Landwirtschaft verfassen.» In einem solchen Bericht wird etwa aufgezeigt, wie viel Treibstoff der Traktor für welche Aufgabe verbraucht hat und wie viel von welchem Pflanzenschutzmittel ausgetragen wurde. «Die Daten sind da, die Maschinen sind technisch auf dem neusten Stand. Mit Large Language Modellen kann man nun die Berichte so weit automatisieren, dass die Landwirte sich nicht darum kümmern müssen – sie müssen sie nur noch in Ruhe durchlesen und abschicken.»
«Wie können wir Menschen von anstrengenden oder stressigen Aufgaben entlasten?»
Mit dem Laser gegen Käfer
In Tänikon tüfteln die Forscher des ISF auch an Methoden, die Pflanzenschutzmittel eines Tages überflüssig machen könnten. Zum Einsatz kommt dabei ein Laser aus der Augenmedizin von Pantec Biosolutions, der auf einem Trägerroboter zentimetergenau in einem Feld positioniert werden kann. Der Laser selbst zielt sogar millimetergenau auf einen Punkt und kann Schädlinge eliminieren. «Einen Käfer oder eine Raupe zu treffen, ist einfach, einen Floh von zwei Millimetern Grösse zu erwischen, ist anspruchsvoller», sagt Dejan Šeatović. Mit dem Laserstrahl kann auch Unkraut zerschnitten werden. Der spezielle Laser hat eine besonders hohe Absorption in Wasser und Chitin, weshalb geringere Strahlendosen notwendig sind – und der Laser weniger Energie benötigt. Das Konzept in einem alltagstauglichen System umzusetzen, ist höchst anspruchsvoll.
Die Laser-Komponente kann auf einen Traktor montiert werden, ebenso auf einen Anybotics-Roboter mit vier «Hundebeinen» oder auf kleine autonome Fahrzeuge. «Der Träger ist fast irrelevant – den Laser kann man sogar auf eine fliegende Drohne montieren», sagt Dejan Šeatović.
Auch interessant
Wasser gegen Unkraut
Agroscope hat eine Methode zur Bekämpfung von Unkraut wie etwa Blacken mit heissem Wasser entwickelt: Eine rotierende Scheibe, ähnlich wie bei Hochdruckreinigern, schiesst fast kochendes Wasser kegelförmig in den Boden und erwärmt so die Erde um die Wurzeln der Pflanze auf über 60 Grad. Dadurch werden die Aminosäuren zerstört, und die Pflanze geht ein. Blacken (Stumpfblättriger Ampfer) sind Pfahlwurzler und breiten sich rasch aus. Beim herkömmlichen Stechen von Blacken entsteht ein unerwünschtes Loch, wenn die Pflanze herausgezogen wird. Mit der Heisswassermethode gibt es nur etwas Matsch; die abgestorbene Pflanze dient sogar noch als Dünger. Die ISF-Forscher rund um Dejan Šeatović experimentieren aktuell daran, ein solches Werkzeug auf einen Trägerroboter zu setzen. «Wir sind hier in der Probephase, es gibt noch kein marktreifes Produkt.»
Für die manuelle Behandlung gibt es solche Systeme bereits, dabei wird das heisse Wasser mit einem Durchlauferhitzer erzeugt, was viel fossilen Brennstoff benötigt. Die Forscher möchten nun das heisse Wasser mit Solarthermie in einem grossen Behälter am Feldrand erzeugen und jeweils kleine Mengen davon in den Tank des Roboters füllen, womit dieser nicht so viel Energie benötigt. Damit der Roboter weiss, wo er überhaupt wirken soll, kann zuvor eine Drohne das Feld abfliegen und mit einer Bilderkennung die Schädlingspflanzen detektieren und dann deren Position an den Roboter mit dem Werkzeug melden. Damit ist aber noch nicht genug an Komplexität: Das autonom arbeitende System muss auch Sicherheitsaspekte berücksichtigen. «Menschen und Tiere können sehr neugierig sein. Das System muss also erkennen, ob sich jemand nähert und sich gefährden könnte», gibt Dejan Šeatović zu bedenken. «90 Grad heisses Wasser mit 130 Bar zu spritzen, ist nicht ohne.» Der Forscher ist überzeugt, dass sich mit solchen Methoden Herbizide und Pestizide weitgehend ersetzen lassen. «Fungizide werden wir nicht so schnell wegbekommen – nach jetzigem Stand des Wissens müssen wir sie weiterhin einsetzen.»
Gesetze müssen sich ändern
Wenn solche technischen Innovationen den Praxistest bestanden haben, braucht es die Landmaschinenindustrie, die solche Geräte produziert und auf den Markt bringt. Die Hürde dabei: Um die gut funktionierenden heutigen Methoden zu ersetzen, muss eine neue Methode deutlich besser sein. «Die Produkte auf dem Markt, die gegenwärtig von den Landwirten eingesetzt werden, sind sehr gut», weiss Dejan Šeatović. «Sie sind ausgereift und effizient.» Bei der Behandlungszeit ist die Unkrautbekämpfung mit heissem Wasser dem heutigen Einsatz von Herbiziden klar unterlegen. Ein Feld von fünf Hektaren konventionell zu spritzen, dauert heute zwei Stunden. Der Roboter mit dem heissen Wasser bräuchte wohl eine ganze Woche. Dazu kommt, dass die Hightech-Roboter im Vergleich zu herkömmlichen Gerätschaften zu Beginn teuer sein werden. «Das bedeutet, dass wir an mehreren Fronten erfolgreich sein müssen», weiss Dejan Šeatović. «Auch die Gesetzeslage müsste sich ändern, sodass robotische Systeme selbstständig auf der Strasse, in der Luft sowie auch auf dem Feld und im Stall arbeiten dürfen.» Erst dann können solche Systeme kosteneffizient eingesetzt werden.
«Das System muss erkennen, ob sich jemand nähert und sich gefährden könnte.»
Noch sind Systeme nicht autonom
Eine bessere Alternative sind autonome Systeme aber erst, wenn sie ihre Fähigkeiten voll ausspielen dürfen. Auf der Strasse ist heute noch kein autonomes Fahren zugelassen – das gilt für Autos genauso wie für landwirtschaftliche Roboter. Dürfte ein Roboter zur Schädlingsbekämpfung allein bis zum Feld fahren, würde die langsamere Arbeitsweise eines solchen Systems wesentlich weniger ins Gewicht fallen. «Wenn der Roboter wirklich autonom einen Auftrag erfüllen kann, dann kann sich der Landwirt in dieser Zeit etwas Anderem widmen», unterstreicht Dejan Šeatović. Auch landwirtschaftliche Drohnen dürfen bisher nicht ausserhalb des Sichtfelds geflogen werden. «Viele solcher Fragen müssen noch gelöst werden.» Deshalb sieht es Dejan Šeatović als eine Aufgabe des Forschungsverbunds in Tänikon an, aufzuzeigen, dass die Technologie erfolgreich eingesetzt werden kann. «Ein Roboter kann perfekt sein, aber wenn die Akzeptanz des Menschen nicht da ist und das Gerät viel Geld kostet, wird er nie eingesetzt werden.»
Auch interessant
Roboter soll mit Roboter kooperieren
Anhand von Satellitenbildern ist es möglich, die Heterogenität des Bodens zu erkennen – allerdings nur in den obersten zwei Millimetern. Das ISF will Stellen, die eine genauere Betrachtung erfordern, detailliert analysieren können und entwickelt im Rahmen eines EU-Forschungsprogramms Bodensonden, die nicht mehr hydraulisch funktionieren, 400 Kilogramm schwer sind und auf Traktoren montiert werden müssen. «Unser Bohrer soll auf dem hundeähnlichen Anybotics-Roboter montiert werden, darum wiegt das System maximal 15 Kilogramm inklusive Akku», erklärt Dejan Šeatović. Damit wird an den Stellen, die aufgrund der Satellitenbilder nicht homogen erscheinen, eine Probe entnommen, die von einem weiteren Roboter an ein mobiles Labor gleich neben dem Feld geliefert und automatisch analysiert wird. Heute werden Bodenproben an ein Labor geschickt.
Ohne menschliches Zutun kooperieren Roboter mit Robotern: Ein Roboter bohrt das Loch, extrahiert die Probe und verpackt sie in kleine Dosen, ein zweiter Roboter holt die Dosen und bringt sie ins Labor am Feldrand. Die Analyse ist in einer Stunde fertig. So erhält der Landwirt ein exaktes Raster über das ganze Feld und weiss, wo es wie viel von welchem Dünger braucht und wo eine Bewässerung notwendig ist.
Nachhaltige Innovation
Dejan Šeatović selbst ist eigentlich Vermessungsingenieur, seit 2006 arbeitet er im Bereich Robotics. Man brauche eine gewisse Flexibilität und müsse sich auf Veränderungen einlassen, deshalb stellt er sich den vielfältigen Herausforderungen der Landwirtschaft: «Ich fühle mich wie jemand, der zum ersten Mal zum Mond fliegt.» Der Flug zum Mond war ein grosser Schritt für die Menschheit – der Landwirtschaft sagt Dejan Šeatović einen Quantensprung voraus. «Der wird wirklich gross!» Dieser Schritt müsse gelingen, nur schon aus Nachhaltigkeitsüberlegungen. Kommt dieser grosse Schritt, müssten Landwirte Samstag und Sonntag nicht mehr arbeiten. «Stattdessen kann eine Maschine gleich neben Wohnhäusern auch nachts ein Feld bearbeiten, weil sie leise ist und niemanden stört.»
Text: Philipp Landmark
Bild: Gian Kaufmann