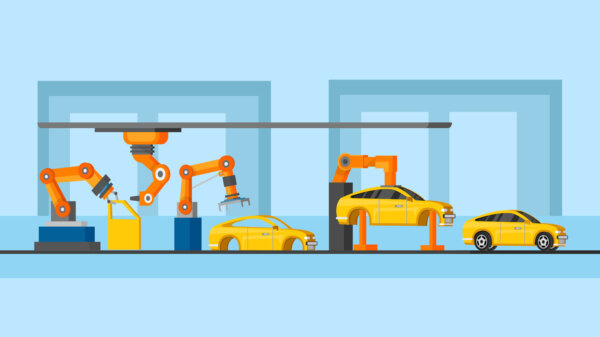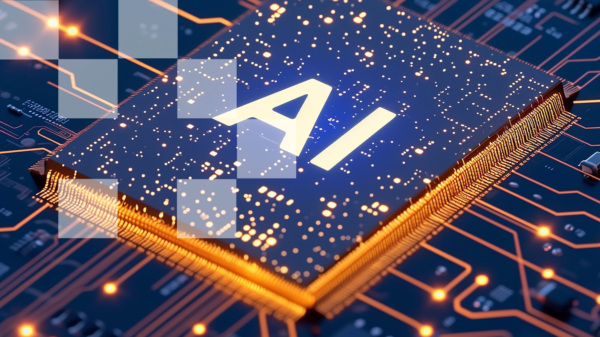Wo das Tierwohl offensichtlich ist

Die Lage beim gleichnamigen Kloster müsste eigentlich das Alleinstellungsmerkmal des Bauernhofs Notkersegg sein. In der Wahrnehmung vieler St.Galler sind es aber die drei Verkaufsautomaten direkt am Spazierweg, die rund um die Uhr allerlei Köstlichkeiten bereithalten und sich nach dem Verkauf sogar artig bedanken. Längst ist die Direktvermarktung eigener Produkte für viele landwirtschaftliche Betriebe zu einem wichtigen Standbein geworden. Beim Bauernhof Notkersegg gehört seit neun Jahren ein reichhaltiges Fleischsortiment zum Angebot.
«Wir haben 48 Hektaren Land, alles in der Bergzone 1, die meisten unserer Flächen sind in Hanglage, zwischen 800 und 900 Metern über dem Meer», sagt Bäuerin Petra Fäh. Die Höhenlage führt dazu, dass die Vegetation im Frühling später erwacht und die Pflanzen im Herbst das Wachstum früher einstellen als beispielsweise am Bodensee. Die Topografie schränkt die Bewirtschaftungsmöglichkeiten zusätzlich ein. «Ackerbau oder Obstbau wären hier nicht sinnvoll. Deshalb liegt es nahe, auf dem Grasland Milch und Fleisch zu produzieren», sagt Petra Fäh. Auf dem Bauernhof Notkersegg steht seit jeher die Milchwirtschaft im Vordergrund. Und Fleisch ist bei der Milchwirtschaft – wie eigentlich bei jeder Tierhaltung – ein logisches Nebenprodukt.
Gutshof wird Pachtbetrieb
Schon die Eltern von Thomas Fäh bewirtschafteten den Bauernhof, der dem benachbarten Kloster Notkersegg gehört. Werner und Trudi Fäh kamen 1969 auf den Hof, Werner Fäh wurde als Betriebsleiter eingestellt. Das blieb so bis kurz vor der Jahrtausendwende. Die neue Direktzahlungsverordnung sah dann aber vor, dass Beiträge nur an Personen mit landwirtschaftlicher Ausbildung ausgerichtet werden können – und somit nicht mehr ans Kloster. Deshalb wurde der Gutsbetrieb, wie viele andere im Land, in einen Pachtbetrieb umgewandelt. Ab 1998 lag die unternehmerische Verantwortung bei der Familie Fäh, seit 2008 bei Thomas und Petra Fäh. Ein Pachtverhältnis bedeutet, dass die Pächter in allfällige Verbesserungen des Betriebs oft selbst investieren müssen, obwohl ihnen der Hof nicht gehört. Tatsächlich haben die Pächter seit 1998 immer wieder ins Tierwohl investiert. Unter anderem bekamen erst die Milchkühe, dann auch die Rinder einen Laufstall, beide Bauten wurden im Baurecht erstellt. Solche Investitionen müssen über eine lange Zeit abgeschrieben werden, weshalb künftige Investitionen gut überlegt sein wollen.
Die muttergebundene Kälberaufzucht, die erst seit fünf Jahren in der Schweiz erlaubt ist, wäre ein mögliches Investitionsvorhaben. In dieser Haltungsart kann ein Kalb bei der Mutter trinken, der Rest der Milch wird gemolken und verwertet. «Würden wir auf dieses System umstellen wollen, müssten wir den ganzen Stall umbauen. Es braucht Kälberbuchten, es braucht Abteilungen, wo die Mütter zu den Kälbern gehen können», erklärt Petra Fäh. Dafür müssten die Pächter wohl gegen 100’000 Franken für eine Anlage ausgeben, die nicht ihnen gehört. Bis zu ihrer Pensionierung würde sich diese Ausgabe nicht rechnen.
Kühe sind gerne im Stall
Hoch über dem Kloster Notkersegg liegen einige Rinder im saftigen Gras einer Weide auf dem Freudenberg. Im Hintergrund ist an diesem sonnigen Herbsttag der Bodensee zu sehen, doch die Postkartenidylle interessiert das Vieh nicht. Auch Landwirt Thomas Fäh, der auf der Wiese nebenan am Zämetue ist, bekommt kaum Aufmerksamkeit. Dabei sind die Rinder bald einmal Nutzniesser von Thomas Fähs Tun: Er formt das zuvor gemähte Gras mit dem Heuwender zu Maden, später wird es mit der Ballenpresse aufgenommen und zu Siloballen verarbeitet – Futter für Kälber, Rinder und Kühe auf dem Hof hundert Höhenmeter weiter unten.
Dort unten, auf einer Weide gleich neben dem Bauernhof, haben die 38 Milchkühe des Betriebs seit 8 Uhr morgens frisches Gras gefressen. Doch gegen Mittag haben sie wörtlich Stalldrang und warten, dass der Zugang zum Hofareal geöffnet wird. Als Petra Fäh den Zaun öffnet, ist ein Helfer noch nicht parat: Hofhund Benno. Er hat die Aufgabe, die Kühe speditiv zum Stall zu geleiten, doch als er auftaucht, haben sich die Kühe schon selbst auf den Weg gemacht. Der Appenzeller-Mischling zeigt dann, dass er seinen Job doch ernst nimmt, die Kühe lassen sich geduldig lenken. Der Hofhund weiss: Wenn er zu übereifrig wird, kann es sein, dass ihn eine Kuh mit einem dezenten Tritt zurechtweist. Die Milchkühe gehen stets gerne zurück in den Stall, vor allem dann, wenn es warm ist. «Die Kühe haben es gerne etwas kühl, am liebsten etwa 5 bis 10 Grad», sagt Petra Fäh. Im Stall laufen an diesem sonnigen Herbsttag grosse Lüfter in der Stirnwand. «Im Sommer muss man sie schon etwas motivieren, dass sie überhaupt rausgehen», erklärt Thomas Fäh, der gerade mit dem Traktor von der oberen Wiese zurückgekommen ist.
Auf der Weide frassen die Kühe gerade noch frisches Gras, im Stall können sie nun Silage fressen. Gemähtes Gras bleibt dafür mindestens fünf Wochen in Siloballen, damit der Gärungsprozess genügend Zeit hat. Spätestens nach einem Jahr müssen die im Volksmund «Mozzarella» genannten Siloballen genutzt werden – rechtzeitig, bevor es Nagetiere tun.
Auch interessant
Heustock abgebrannt
Eigentlich bekämen die Kühe ihre Silage gemischt mit Heu, doch das fehlt momentan. Der Heustock auf dem Hof ist vor einem Jahr spektakulär abgebrannt: Der Heukran fing Feuer, während Petra Fäh ihn bediente und somit darauf sass. Sie konnte sich im letzten Moment retten; auch zwei Helfer im Heustock konnten sich mit Hilfe von Nachbarn und Passanten in Sicherheit bringen. Kälber, die im Stall dieses Gebäudes waren, konnten rechtzeitig herausgeholt werden. Die rasch eingetroffene Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf weitere Gebäude überschlugen – der Heustock jedoch brannte ab.
Glück im Unglück nennt man das wohl. Die Fähs blicken nach vorne, der Heustock wird in nächster Zeit wieder aufgebaut. «Die Baubewilligung ist da», sagt Thomas Fäh. Weil die Kühe Gras, Silage und Heu aus dem eigenen Betrieb fressen und strikt kein Soja zugefüttert wird, ist die Milch vom Bauernhof Notkersegg sowohl als Wiesenmilch gemäss IP Suisse wie auch als Bergmilch zertifiziert. Für diese Labels muss auch eine artgerechte Haltung mit Auslauf und täglichem Weidegang während der Vegetationsperiode gewährleistet sein. Als zusätzliches Energiefutter erhalten die Kühe Nebenprodukte der Getreideproduktion, vor allem von Weizen und Mais aus nachhaltigem Anbau. Das schmeckt nicht nur den Kühen: Wenn Thomas Fäh etwas Getreide auf die Silage streut, stibitzt sich auch Benno etwas davon.
Selbstständig zum Melken
Im Stall können sich die Milchkühe frei bewegen – obwohl sie gerade von der Weide kommen, zieht es alle erst einmal zu den Futterluken und zu einem Happen Silage. Thomas Fäh beobachtet das Verhalten seiner Tiere aufmerksam: «Alle Kühe sind zurückgekommen, alle fressen – das ist ein gutes Zeichen.»
Nach dem Fressen trotten manche Kühe zu den Liegebuchten, andere machen etwas Wellness unter einer grossen rotierenden Bürste. Nach und nach gehen die Tiere zum Gatter, das zum Melkroboter führt. Dort wird ein Chip am Halsband der Kuh ausgelesen. Wenn die Daten der Hof-IT es ebenfalls plausibel finden, dass es für diese Kuh Zeit zum Melken ist, wird sie eingelassen. Im Stand des vollautomatisierten Melkroboters werden die Zitzen der Kuh zuerst gereinigt und massiert, um sie anzuregen, bevor die Melkschläuche angesetzt werden. Junge Kühe muss man zunächst an den Ablauf und an den Stand im Melkroboter gewöhnen; bald wird es für die Tiere zur mehrmals täglichen Routine. Im Schnitt über alle Kühe werden täglich etwa 25 Liter pro Tier gemolken. Kühe direkt nach einer Geburt liefern bis zu 40 Liter, dafür stellen sie sich drei- oder viermal beim Melkroboter an. Kühe, bei denen eine Geburt schon länger zurückliegt, geben oft nur noch zehn Liter Milch. All diese Daten werden im IT-System detailliert aufgezeichnet; bei ungewöhnlichen Abweichungen schickt das System Thomas Fäh einen Warnhinweis aufs Handy. Landwirte von heute müssen durchaus technikaffin sein.
Während des Melkens kann jede Kuh quasi als Dessert etwas Kraftfutter fressen, danach zieht der Roboterarm die Melkschläuche ab, und die Kuh verlässt den Stand. Gleich neben der Melkvorrichtung wird die Milchqualität in einem automatisierten Labor analysiert. Würde ein Parameter nicht stimmen, wird die Milch abgeleitet und separiert – sonst kommt sie in den Milchtank. Abgeholt und verarbeitet wird die frische Milch von der Molkerei Biedermann in Bischofszell, einem Tochterunternehmen von Emmi.
Ohne Nachwuchs keine Milch
Dass ein auf Milchwirtschaft ausgerichteter Betrieb auch in der Zucht aktiv ist, liegt auf der Hand. Denn ein Rind wird erst dann zur Milchkuh, wenn es Nachwuchs hat. Zum ersten Mal besamt werden Rinder im Alter von etwa eineinhalb bis zwei Jahren. Nach einer Tragzeit von neun Monaten und zehn Tagen kommt das Kalb zur Welt. Nach der Geburt werden die Kühe im nächsten Zyklus wieder besamt; im Schnitt bekommt eine Kuh einmal pro Jahr ein Kalb.
Die 38 Milchkühe auf dem Bauernhof Notkersegg sind – bis auf eine Holsteiner-Dame als Ausnahme – alles Tiere der Rinderrasse Brown Swiss, also Braunvieh. «Wenn der Nachwuchs einer schönen, fitten Milchkuh auch wieder eine Milchkuh werden soll, dann wird sie mit Braunvieh besamt», erklärt Petra Fäh. Dabei wird gesexter Samen verwendet; die Wahrscheinlichkeit, dass die Kuh ein weibliches Kalb gebärt, liegt bei rund 90 Prozent. Zwischen zehn und fünfzehn Braunvieh-Kälber für die eigene Aufzucht kommen hier jedes Jahr auf die Welt.
Die anderen Milchkühe werden mit einer Mastrasse wie Charolais, Limousin oder Angus besamt. Deren Nachwuchs entwickelt mehr Muskelmasse und wird zu Mastkälbern oder Mastrindern.
«Wenn der Nachwuchs einer schönen, fitten Milchkuh auch wieder eine Milchkuh werden soll, dann wird sie mit Braunvieh besamt.»
Der Metzger kommt auf den Hof
Steht für ein Kalb, Rind oder auch eine Kuh der Schlachttermin an, wird das Tier nicht zum Metzger gefahren – der Metzger kommt auf den Hof. Der Betrieb hat in Zusammenarbeit mit der Waidwerker GmbH von Damian Signer aus Appenzell auf Hoftötung umgestellt, was den Tieren einiges an Stress erspart. Metzger Signer besitzt die dafür notwendigen Spezialbewilligungen; er verarbeitet das Fleisch anschliessend in seiner Metzgerei und lagert es drei bis vier Wochen.
2007 begann Petra Fäh, verschiedene Produkte des Bauernbetriebs direkt zu verkaufen. Eier oder Apfelsaft können Passanten seither aus den Verkaufsautomaten gleich am Spazierweg beziehen. «Verschiedene Kunden haben uns gefragt, ob sie nicht auch Fleisch bei uns kaufen könnten», sagt Petra Fäh. «Wir dachten zuerst, das sei mit Kühlung und Transport wohl zu kompliziert.» Doch der Gedanke liess sie nicht los. Deshalb besprach sie die Option mit dem Lebensmittelkontrolleur. Ergebnis: «Das ist machbar.»
Auch interessant
Vollständige Verwertung
Seit 2016 gibt es den Fleischverkauf ab Hof, wofür die Familie Fäh mit verschiedenen Metzgern zusammenarbeitet. Über einen Newsletter des Bauernhofs Notkersegg werden die registrierten Kunden über den nächsten Fleischverkauf informiert; im eigenen Onlineshop können sie verschiedene Fleischsorten und Packungsgrössen bestellen. Bei Kalbfleisch sind dies neben gängigen Stücken beispielsweise auch geräucherte Zungen – wird ein Tier geschlachtet, soll es möglichst vollständig verwertet werden.
Die Wünsche der Kunden werden Damian Signer mitgeteilt; er konfektioniert die Bestellungen sowie auch das restliche Fleisch und fährt es an einem Freitagvormittag mit dem Kühlwagen auf den Hof. Am Nachmittag und am Samstag können die Kunden ihre Bestellungen abholen oder spontane Käufe tätigen. Fleisch, das nicht sofort verkauft wird, kommt in den nächsten Wochen tiefgefroren in einen Verkaufsautomaten. Wird eine alte Milchkuh geschlachtet, kommt das Fleisch nach der Hoftötung zu Köbi Rempfler in Lütisburg, der daraus Produkte wie Fleischkäse, Bauernschüblig und Salziz macht – sie werden ebenfalls im Bauernhof verkauft.
Neben den Kälbern und Rindern werden auf dem Bauernhof stets auch drei bis acht Schweine in einem grossen Stall mit Aussenbereich gemästet. Diese Tiere kommen im Alter von drei Monaten vom Bauernhof der Familie Ackermann in Guggeien in die Notkersegg. Die Schweine werden zu André Bühler in Heiden gefahren und dort gemetzget – ebenso die rund zwanzig Truten, die es seit fünf Jahren auf dem Hof gibt und die jeweils Ende November geschlachtet werden. Auf dem Bauernhof gibt es zudem etwa 120 Legehennen, die im Alter von rund zwanzig Wochen auf den Hof kommen. Während etwa eines Jahres legen die Tiere täglich ein Ei.
«Verschiedene Kunden haben uns gefragt, ob sie nicht auch Fleisch bei uns beziehen könnten.»
200 Hochstammbäume
Das Hoflädeli ist jeweils auf Vorankündigung geöffnet, wenn ein Fleischverkauf abgeschlossen wird. Hier finden sich auch Produkte anderer Bauern – verschiedene Käsesorten etwa oder Honig der benachbarten Imkerei von Peter Falk. Das ganze Jahr über sind Hofprodukte in den drei Verkaufsautomaten erhältlich, und dort erahnt man die ganze Vielfalt des Betriebs. Denn im Angebot findet sich auch die Ernte von den rund 200 Hochstamm-Obstbäumen des Betriebs: Kirschen, Walnüsse und vor allem Apfelsaft. Längst kein Geheimtipp mehr sind die Bratwürste, die vor allem in der Grillsaison in den Automaten angeboten werden. Dafür fährt Petra Fäh eigenes Kalbfleisch, das Damian Signer beiseitegelegt hat, zu André Bühler, der zusammen mit Schweinefleisch – idealerweise ebenfalls vom Hof – die Bratwürste herstellt. Ein etwas aufwendiger Prozess, der aber in einem wirklich grossartigen Produkt mündet und einem Bauernhof in der Bratwurst-Stadt alle Ehre macht.
Das Vertrauen der Kunden
Der Fleischverkauf auf dem Hof lief von Anfang an gut; heute wird sämtliches Fleisch des Hofs über diesen Kanal abgesetzt. Die Preise sind nicht höher als Label-Fleisch bei einem Grossverteiler. Für die Landwirte ergibt das eine «einigermassen gute Marge». Die brauche es auch, betont Petra Fäh: «Sonst müsste ich auswärts arbeiten gehen.»
Das Landwirtepaar hat einen fixen Tagesablauf und eine klare Aufgabenteilung, beide können aber aushelfen und den Job des anderen übernehmen. Die Direktvermarktung ist Petra Fähs Ressort; sie ist es auch, die regelmässig Bilder und Videos auf Instagram und Facebook postet – kleine Geschichten und Anekdoten aus dem Hofalltag, weniger als Promotion für den Direktverkauf gedacht, vielmehr will Petra Fäh Verständnis für die Bauern schaffen. «Früher fragten Leute noch nach der Produktionsart, heute ist das Label weniger wichtig, wenn sie sehen, dass die Tiere Auslauf haben», sagt Petra Fäh.
Der Bauernhof Notkersegg liegt mitten in einem populären Ausflugsgebiet; ständig kommen Biker, Spaziergänger, Hündeler oder Reiter an Ställen und Weiden vorbei. «Sie sehen die Kälber und Rinder grasen und springen – das zeigt offensichtlicher als jedes Label, dass es ihnen gut geht.» Das Tierwohl sei auch den Kunden wichtig: «Es ist schön für uns zu spüren, dass es ihnen nicht nur auf ein Label ankommt, sondern sie uns vertrauen.»
Text: Phillip Landmark
Bild: Marlies Beeler-Thurnheer