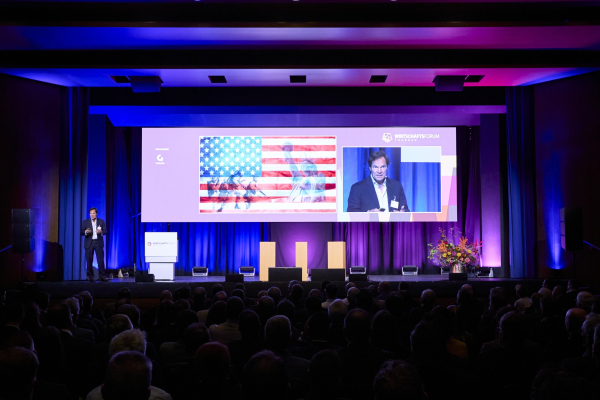Demenz: Gemeinsam verstehen und handeln

Text: Diana Staudacher, OST
«Oft ist herausforderndes Verhalten ein Ruf nach Verständnis und Sicherheit in Situationen der Angst und Überforderung», so Charlotte den Hollander (Bundesamt für Gesundheit) in ihrem Grusswort an die fast 950 Teilnehmenden. Hinter Aggression, Rufen, Schreien oder motorischer Unruhe verbirgt sich oft «ein tiefes Bedürfnis nach Halt. Als Fachpersonen bieten Sie den Betroffenen diesen Halt», betonte Charlotte den Hollander. Sie dankte den Pflegefachpersonen und Angehörigen für ihren täglichen Einsatz.
«Wir sprechen heute nicht nur über das Verhalten von Menschen mit Demenz, sondern auch über ihre Bedürfnisse und Wünsche», sagte Prof. Steffen Heinrich (Co-Leiter des Kompetenzzentrums Demenz/OST). Wissen und Verstehen sind gefragt, um bei «herausforderndem Verhalten» hilfreich handeln zu können. Vier Keynotes, drei Sessions und zwei Workshops gaben hierfür vielfältige Impulse.
«Menschen mit Demenz wollen nicht belastend sein für andere», betonte Dr. Laura Adlbrecht (Co-Leiterin des Kompetenzzentrums Demenz/OST). Doch je mehr die Krankheit fortschreitet, desto schwieriger wird die Impulskontrolle. Sich verbal mitzuteilen, gelingt immer seltener. Das Verhalten wird zur Ausdrucksprache.
Umso wichtiger ist es für Fachpersonen und Angehörige, diese Sprache zu verstehen. Menschen mit Demenz haben kaum noch «Mittel, um deutlich zu machen: Stopp – das will ich nicht». Wer sich bedroht und ohnmächtig fühlt, schützt sich mit Händen und Füssen.
Nach Ursachen suchen
«Herausforderndes Verhalten sollte uns herausfordern, nach dessen Ursachen zu suchen.» Diese Aufforderung des Demenzforschers Ian James zog sich wie ein Leitmotiv durch den Kongress.
Welche Ursachen haben Rufen und Schreien bei Menschen mit Demenz? Jürgen Georg (Hogrefe Verlag) stellte Erklärungsmodelle vor. Anhaltendes Schreien und wiederholtes Rufen haben Signalfunktion. Sie können eine Not mitteilen – wenn Worte fehlen. Ziel ist oft, Schmerz und Unbehagen abzuwenden. Frustration und Leiden können schreiend zum Ausdruck kommen. Bedeutsam ist auch eine verringerte Stresstoleranz. Menschen mit Demenz geraten schnell an die Grenze ihrer Belastbarkeit. Überforderung und Überstimulation sind häufige Auslöser. Eine veränderte Umgebung, der Verlust von Routine oder eine fehlende Bezugsperson – dies sind verstörende Erfahrungen für Betroffene. Etwas nicht mehr zu können und ständig zu Leistung ermahnt zu werden, ist schwer zu ertragen. Erfolgen pflegerische Handlungen unangekündigt, kann die Irritation stark sein.
Die Suche nach Ursachen des Schreiens sei eine pflegerische «Detektivarbeit», so Jürgen Georg. Interpretiert die Fachperson den Schreigrund richtig? Hört das Rufen auf? Hält es an? Die Ursachensuche verläuft nach dem Trial-and-Error-Prinzip. So stellt sich für Pflegende die Frage: «Wie schaffe ich Begegnung, die mir beim Verstehen und dann vielleicht beim Verändern hilft? Ich muss in der Situation bleiben. Also darf ich nicht an mein pädagogisches, therapeutisches oder pflegerisches Ziel denken. Hier und jetzt bin ich bei einem Menschen, der schreit und ich weiss nicht, warum. Das ist nicht leicht auszuhalten!»
BPSD-Symptome: Welche Therapien helfen?
Demenz umfasst weit mehr als das Erleben von Gedächtnisverlust: Apathie, Depression, Agitation, motorische Unruhe und Reizbarkeit zählen zu den «Behavioralen und Psychischen Symptomen der Demenz» (BPSD). «Fast alle Menschen mit Demenz entwickeln im Verlauf der Erkrankung mehrere BPSD», berichtete Prof. Dr. Egemen Savaskan (Psychiatrische Universitätsklinik Zürich). Er erläuterte die aktualisierten Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Alterspsychiatrie und -psychotherapie (SGAP). Sie bilden den aktuellen Stand des Wissens zur Therapie von BPSD. Der wichtigste Grundsatz lautet: Therapie der ersten Wahl sind nicht-pharmakologische Therapien, beispielsweise Lichttherapie, Musiktherapie, Kunsttherapie, Psychotherapie oder tiergestützte Therapien.
Falls diese nicht ausreichen, können vorübergehend pharmakologische Therapien zum Einsatz kommen. Doch das Risiko von Nebenwirkungen ist hoch. Daher sollte die Dosis möglichst tief und individuell angepasst sein. Eine Besonderheit besteht darin, dass «Psychopharmaka in der Alterspsychiatrie häufig off label zur Anwendung kommen», so Prof. Savaskan. Oft fehlen kontrollierte Studien zur Wirksamkeit von Medikamenten bei älteren Menschen. Auch die Evidenz für nicht-medikamentöse Therapien ist gering. Umso wichtiger ist es, die klinische Expertise der Fachpersonen einzubeziehen.
Zuerst dem Menschen begegnen
«Bevor ich handle, suche ich den Menschen», betonte Dr. Astrid Steinmetz (KoW®-Training). Sie zeigte auf, wie bedeutsam der Beziehungsaufbau zu Menschen mit Demenz ist. «Herausforderndes Verhalten» lässt sich oft verhindern, wenn der Beziehungsaufbau gelingt: «Beziehung zu suchen, ist keine Zeitverzögerung – sie ist Intervention und Prävention.» Es braucht keine Worte, um einander zu begegnen. Blickkontakt und Zugewandtheit vermitteln der Person mit Demenz eine Schlüsselerfahrung: Ich bin gemeint. Wer sich erkannt, verstanden und ernst genommen fühlt, empfindet Sicherheit. Das Erleben von Bedrohung, Ohnmacht und Angst lässt sich durch Beziehungserleben unterbrechen. Das Leitprinzip lautet «Beziehung vor Handlung».
Menschen mit Demenz in schwierigen Situationen zu begleiten, setzt Rahmenbedingungen voraus. Die Gesundheit der Pflegenden war daher ein wichtiger Aspekt der Workshops und Sessions. Denn auch Fachpersonen können an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gelangen. Somit braucht es Institutionen und Führungspersonen, die Pflegenden den Rücken stärken.
Der Erfahrungsaustausch und die Diskussionen zeigten: Demenz wird in der Gesellschaft noch immer stigmatisiert. Etwa 161'900 Menschen mit Demenz leben in der Schweiz. Bis 2050 werden es schätzungsweise 315'400 sein. Demenz geht die gesamte Gesellschaft an. Daher ist es zentral, die Herausforderungen gemeinsam und kreativ anzugehen.
Der 12. St.Galler Demenz-Kongress findet am 11. November 2026 statt.