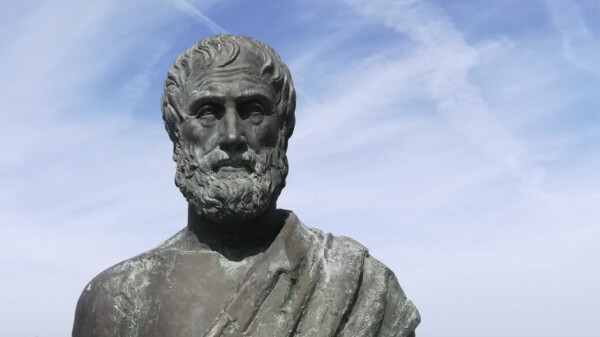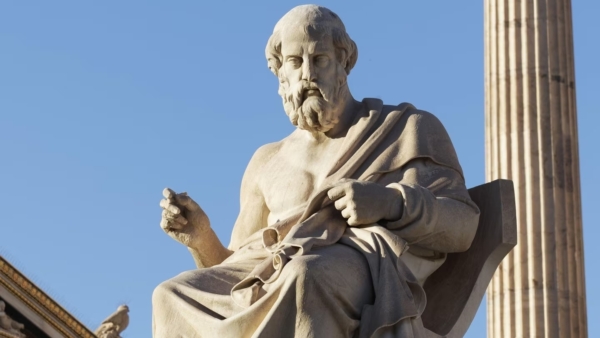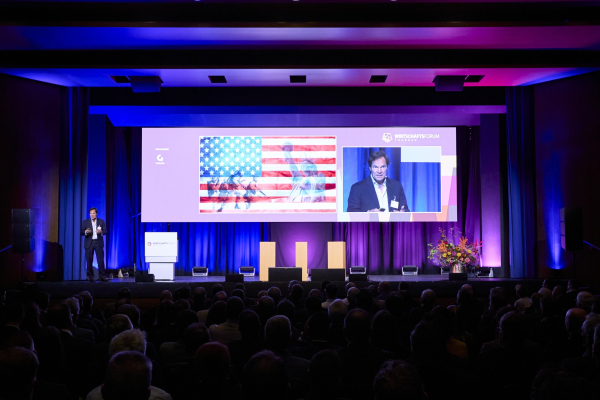Spinozas einfache Formel für gute Mitarbeitergespräche

Text: Louis Grosjean, Partner altrimo
In vielen Betrieben stehen die Jahresendgespräche an. Da kann man sich als Leader unendlich Gedanken machen – vor allem, wenn man etwas philosophieaffin ist. Es wird differenziert, begründet, relativiert, motiviert. Vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht mehr. Geht es auch einfacher?
Spinoza: nutzenorientierte Bündnisse
In den Herbstferien habe ich eine Stelle im Tractatus politicus des Philosophen Baruch de Spinoza gelesen, die eben zu einer viel einfacheren Betrachtung führt. Diese nutze ich als Reflexionsbasis in diesem Artikel.
Zunächst zu Spinoza: Der niederländische Philosoph mit Wurzeln in der jüdischen portugiesischen Gemeinschaft lebte im 17. Jahrhundert und starb früh. Er befasste sich mit Metaphysik, Ethik, politischer Philosophie und Erkenntnistheorie. Im Tractatus politicus äussert er sich zu zwischenmenschlichen Bündnissen – sei es im Arbeitsverhältnis (Kap. 2, § 10) oder im Verkehr zwischen Staaten (Kap. 3, § 14).
Spinoza sagt sinngemäss Folgendes: Ein Bündnis bleibt so lange erhalten, wie die Mitglieder Furcht oder Hoffnung aus dem Bündnis schöpfen. Entfallen diese Gefühle, so wird das Mitglied wieder unabhängig. Es ist dann legitim, dass es das Bündnis auflöst.
Baruch de Spinoza drückt es etwas dramatisch aus, aber im Prinzip geht es darum: Geht es mir in Zukunft besser, wenn ich im Bündnis bleibe, beziehungsweise schlechter, wenn ich es verlasse?
Stellen wir die Win-win-Situation fest?
In den Kontext des Arbeitsverhältnisses – verstanden als Bündnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer – übersetzt, heisst das: Entsteht durch die Arbeit des Mitarbeiters ein grösserer Nutzen als der Lohn, den er bekommt? Geht es dem Unternehmen schlechter, wenn er geht, als wenn er bleibt?
Diese rein nutzenorientierte Perspektive mag wenig idealistisch klingen. Jedoch rege ich an, sie ernsthaft anzuwenden, wenn es um das Jahresgespräch geht – und zwar auf beiden Seiten, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer. Letztere tun es ohnehin, wenn wir ehrlich sind. Niemand hat ein Problem damit. Warum also nicht auch als Arbeitgeber? Der Wert dieser Überlegung ist eine schonungslose Auseinandersetzung mit dem Mehrwert, den der Mitarbeiter schafft.
Auch interessant
Stellen Sie sich dazu folgendes Kurzgespräch vor:
Der Unternehmer: «Dank deiner Leistung geht es meinem Unternehmen nächstes Jahr besser.»
Der Mitarbeiter: «Für mich lohnt es sich, nächstes Jahr weiterhin im Unternehmen zu arbeiten.»
Man kann diese Sätze natürlich wertschätzender formulieren, aber es geht um den Inhalt. Wenn Unternehmer und Mitarbeiter beide hinter ihrem jeweiligen Satz stehen können, bleiben sie im Sinne von Spinoza aneinander gebunden – zum gegenseitigen Nutzen. Wenn nicht, kann es zur Bündnisauflösung kommen.
Natürlich bleibt es nicht bei dieser Überlegung. Es gibt Gründe, Werte, soziale Gedanken, Coaching- oder Mentoring-Ansätze. Wenn jemand nicht performt, gibt es ausserdem andere Wege, als «wieder unabhängig» zu werden – sprich, sich zu trennen.
Ich wünsche allen Lesern fruchtbare und inspirierende Jahresendgespräche.