Am Anfang war das Wort
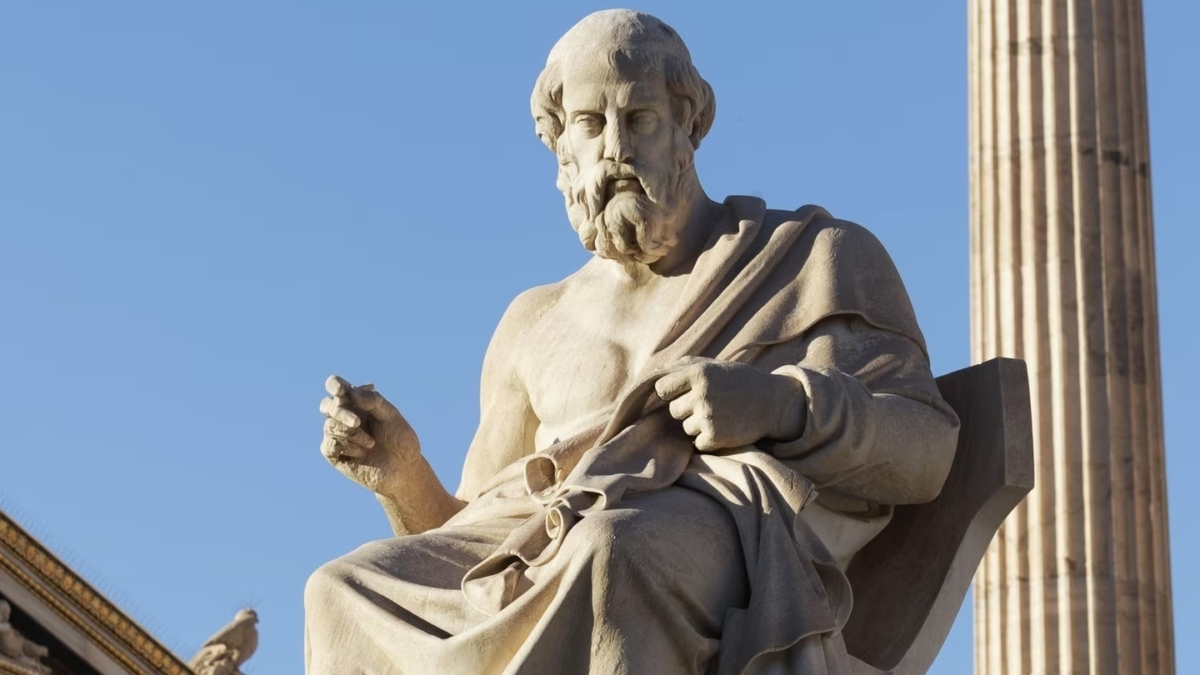
Text: Louis Grosjean, Partner altrimo
Ist Ihnen das auch schon mal widerfahren? Ihr Tischnachbar redet ununterbrochen. Erzählt von sich. Reiht eigene Geschichten aneinander. Bis der Überdruss Sie überwältigt und Sie sich geschickt abwenden, um einen etwas weniger einseitigen Austausch mit einer anderen Person zu suchen.
Auch in Organisationen und Unternehmen sind solche Erfahrungen nicht selten. Alpha-Tiere neigen dazu, das Wort zu monopolisieren. Es scheint eine Korrelation zwischen Redeanteil und hierarchischer Stellung zu geben.
Nun, Führung braucht Kommunikation. Die Frage ist, wie die Verteilung zwischen eigenem Redeanteil und Zuhören aussehen soll. Und was mit dem eigenen Redeanteil zu bewirken ist.
Die Sophisten: die Macht der Rhetorik
In der ersten Demokratie der Welt – Athen – war Rethorik ein Machtinstrument. Die sogenannten Sophisten waren Lobbyisten: Gegen gutes Geld konnte man diese gewandten Rhetoriker dazu benutzen, Botschaften im politischen Meinungsbildungsprozess zu platzieren. Oder man heuerte sie als Rhetorik-Lehrer an, um dank ihrem Unterricht später zu höheren Ämtern berufen zu werden.
Platon hasste die Sophisten. Ihm wird folgende nautische Metapher zugeschrieben: Sophisten lehren einem, am Steuer des Schiffs zu bleiben, anstatt den richtigen Kurs zu wählen.
Genau darin liegt ein vielfach anzutreffendes Dilemma der Führungstätigkeit. Es scheint – besonders in der Politik, aber auch in den politisch geprägten Etagen von Unternehmen – als ob gewisse Führungskräfte ihre Zeit und Energie primär dem Machterhalt und nicht der weisen Führung widmen würden. Ihr Mittel dazu: das Wort.
Platon und die Dialog-Kunst
Dagegen wandte Platon eine von seinem Meister Sokrates erlernte Kunst an: den Dialog. Wer seine Texte liest, erlebt ein Pingpong zwischen verschiedenen Akteuren. Diese versuchen, einander zu überzeugen. Darin ist eine erste Leadership-Lektion zu erblicken: Wer die weise, richtige Entscheidung sucht, findet sie besser im Dialog mit Dritten als zwischen den eigenen Ohren.
Dabei muss der Dialog aufrichtig sein. Eine Gremium-Diskussion, wo jeder auf den Moment wartet, seine argumentative Munition zu verschiessen und den anderen kaum zuhört, ist verschwendete Zeit. Ein aufrichtiger Dialog setzt die Bereitschaft voraus, sich vom Gegenüber dank guter Argumente überzeugen zu lassen und seine erste Meinung zu ändern. Platon war zugegebenermassen nicht immer aufrichtig und gab Sokrates in seinen Dialogen fast immer die Rolle, sein Gegenüber argumentativ zu demontieren. Spannenderweise machte er dies jedoch mit relativ kleinem Redeanteil und v.a. durch aktives Zuhören über Fragen.
Wann aktives Zuhören angebracht ist…
Dass aktives Zuhören zu einer guten Führung gehört, dürfte nicht ernsthaft bestritten sein. Die Frage ist zunächst, wann aktiv geredet und wann zugehört werden soll.
Aktives Zuhören empfiehlt sich zunächst in bilateralen Situationen, wenn das Gegenüber emotional bedrückt erscheint. Wenn ihn etwas emotional beschäftigt, wird dies den sachlichen, argumentativen Dialog stören. Zuerst muss die Emotion verbalisiert werden. Erst, wenn diese Ebene geklärt ist, kann zum Sachthema übergegangen werden.
Aktives Zuhören scheint mir ausserdem z. B. in Gremien wie Verwaltungsrat, Geschäftsleitung oder Team-Sitzungen wichtig zu sein, wenn der Vorsitzende weniger Informationen zum traktandierten Thema als andere Teilnehmer hat. Durch aktives Zuhören und Fragen wird die Informationsasymmetrie so vermindert oder beseitigt, dass der anschliessende Entscheid auf einer besseren Faktengrundlage beruht.
Aktives Zuhören ist aber auch in vielfältigen Situationen ein Mittel zur Herstellung oder zur Verstärkung von zwischenmenschlichen Beziehungen. Oder, ohne weitere Absichten, eine Kundgebung von Interesse am Gegenüber. Durch aktives Zuhören wird dem Gegenüber Wertschätzung signalisiert.
… und wann der Leader aktiv kommunizieren soll.
Manchmal ist es aber ratsamer, das Wort zu ergreifen und zu führen. Dies ist zunächst in Gremien der Fall, wenn der Vorsitzende selber mehr Informationen als die anderen Teilnehmer hat. Dies kann aber auch weitere Zwecke haben.
So gehört zur Führung das Setzen gewisser Leitplanken und das Formulieren eines Ziels zu einem Sachthema. Das geht am effizientesten über aktive, eigene Kommunikation durch den Leader. Zwar kann zum sokratisch-platonischen Frage-und-Antwort-Ansatz gegriffen werden, aber das ist oft zeitraubend. Dieser Ansatz birgt zudem die Gefahr, dass sich die Diskussion verzettelt oder nicht klar wird, was der Leader eigentlich will. Das Schaffen von Orientierung braucht aktive Kommunikation.
Zum Schluss benötigen Krisen eine aktive Kommunikation. Zuhören kann zur Problemerfassung und zur Analyse zu Beginn der Krise gehören, aber bald einmal muss der Leader sagen, wie in Richtung Lösung gesteuert wird.
Was aber die aktive Kommunikation nicht allzu fest bezwecken soll: sich selbst in ein gutes Licht rücken und verkaufen. Ein Häppchen hier und da ist in Ordnung, aber wenn es darüber hinaus geht, wird sich ihr Tischnachbar bald abwenden.























