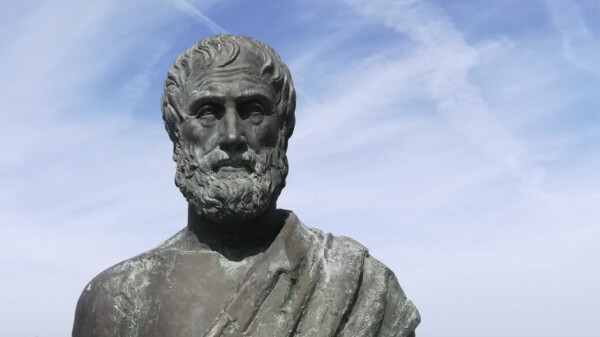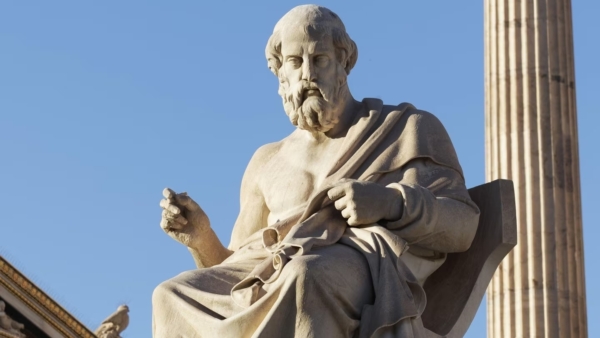Macht gegen Gewalt

Der Krieg tobt in der Ukraine. Ein disymmetrischer Krieg, der auf die Initiative von Präsident Vladimir Putin zurückgeht. Einige Phänomene sind auffallend: die Repression kritischer Stimmen in Russland, der Widerstandswille der ukrainischen Bevölkerung (diese Bilder von menschlichen Strassensperren vor Panzern!) und die Bereitschaft, diesen Willen durch Bombardierung ziviler Ziele zu brechen.
Diese Phänomene stellen eine echte Auseinandersetzung zwischen Macht und Gewalt dar, wie sie einst von Hannah Arendt beschrieben wurden. Arendt ist eine Humanistin und Philosophin des XX. Jahrhunderts. Berühmt geblieben ist unter anderem ihre Analyse des Prozesses von Adolf Eichmann, Nazi-Funktionär, in Jerusalem. In ihrem Werk «Macht und Gewalt» geht sie auf diese beiden Begriffe ein.
Macht und Gewalt schliessen sich aus
Arendt definiert Macht als die Fähigkeit, sich mit anderen zusammenzuschliessen und im Einvernehmen mit ihnen zu handeln. Macht setzt also Legitimität und Kooperation voraus. Sie entspringt einem gemeinsamen Willen. Eine Person hat viel Macht, wenn ihr Wille und ihr Handeln durch die Zustimmung in ihrem Wirkungskreis multipliziert wird. Macht funktioniert nie gegen den klaren Willen anderer. Will er sich in diesem Fall durchsetzen, muss der Machthaber auf Gewalt zurückgreifen.
Gewalt ist nach Arendt hingegen instrumental. Sie ist ein Werkzeug zur Erreichung bestimmter Ziele gegen den Willen der Betroffenen.
Arendt postuliert: Macht und Gewalt sind Gegensätze. Wo die eine absolut herrscht, ist die andere nicht vorhanden. Gewalt tritt auf den Plan, wenn Macht in Gefahr ist.
Beispiele aus Vergangenheit und Gegenwart
«Der Zusammenprall von russischen Panzern mit dem völlig gewaltlosen Widerstand des tschechischen und slowakischen Volkes ist ein Schulbeispiel für eine Konfrontation von Gewalt und Macht in ihrer reinsten Form», sagt Arendt in Bezug auf den Prager Frühling von 1968. Napoleons Niederlage in Spanien und das Scheitern der USA im Vietnam zitiert Arendt als Beispiele, wo Macht die Gewalt schliesslich besiegte. Nicht dass die spanischen Guerilleros und der Viet-Minh keine Gewalt anwenden würden; sie genossen jedoch eine breite Legitimität in der Bevölkerung, was Frankreich und den USA damals fehlte.
Noch frappanter war Ghandis gewaltloser Widerstand gegen die Briten im Kampf für die Unabhängigkeit Indiens. Ein weiteres Beispiel, das sich jedoch nach dem Erscheinen von Arendts Buch zugetragen hat, ist der Afghanistan-Krieg der UdSSR.
Gleichzeitig kann konsequent angewendete Gewalt obsiegen. So geschah es im Ostblock: 1953 in Berlin, 1956 in Ungarn, und eben 1968 in Prag. Um das Beispiel der Unabhängigkeit Indiens wieder aufzugreifen: Kaum zu denken, was mit Indien geschehen wäre, wenn der Unabhängigkeitskampf nicht gegen das britische Königreich, sondern gegen Stalins UdSSR oder Hitlers Deutschland geführt worden wäre. Die kompromisslose Gewaltanwendung hätte vermutlich die Oberhand gewonnen, mit verheerenden humanitären Folgen.
Der Krieg in der Ukraine ist eine erneute Illustration dieser Auseinandersetzung zwischen Gewalt und Macht. Der Einmarsch ist nicht wie von Putin erwartet auf Willkommensgrüsse der ukrainischen Bevölkerung gestossen. Die Invasion durch Profi-Kampfgruppen hat für die Kapitulation nicht gereicht. Eine Machtübernahme mit limitierter Gewalt ist nicht erfolgt. Daher sieht sich der Kreml-Chef gezwungen, gesteigerte Formen von Gewalt wie die Bombardierung ziviler Ziele anzuwenden.
Wenn man die früheren Beispiele aus der Geschichte bedenkt und sich vor Augen führt, dass Gewalt gegen Macht nur durch Kompromisslosigkeit obsiegt, so verheisst dies nichts Gutes für die Ukraine. Bei anhaltendem militärischem Widerstand der Ukraine könnte diese Logik der Gewaltanwendung zur Verwendung weitergehender Gewaltformen führen: das gezielte Aushungern von Regionen oder der Einsatz von taktischen A- bzw. C-Waffen.
Auch interessant
«Was niemals aus den Gewehrläufen kommt, ist Macht»
Gleichwohl erinnert uns Arendt in diesem Zitat an diesen Grundsatz: Gewalt zerstört die Macht. Die Repression von Putin im Inland und die Anwendung von Gewalt gegen eine historisch dem russischen Volk sehr nahe Bevölkerung können ihn die Legitimität und die Zustimmung kosten, die bis anhin die Basis seiner Macht darstellten. Diese Basis war einst sehr solid: Sie gründete auf der Sehnsucht nach sowjetischer Grösse und auf der Wiederherstellung einer gewissen Ordnung nach den Korruptionsjahren unter Boris Jelzin. Doch die Erinnerung an diese Jahre verblasst und die gegenwärtige Gewalt unterminiert die Machtbasis Putins.
Für ihn ist es ein Wettlauf gegen die Zeit: Je länger und drastischer die Gewaltanwendung dauert, desto grösser ist die Gefahr, dass er die Macht verliert. Gelingt ihm ein frühes Ende der Gewaltanwendung, kann er sich wieder der Konsolidierung seiner Machtbasis zuwenden.