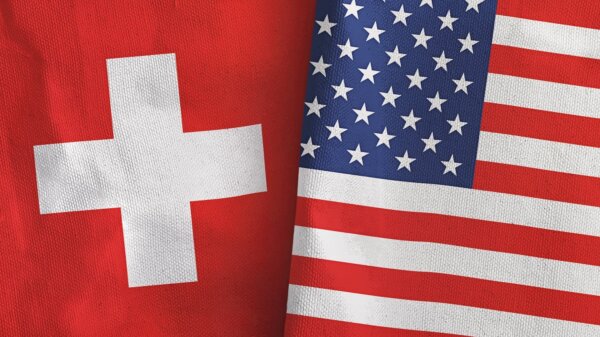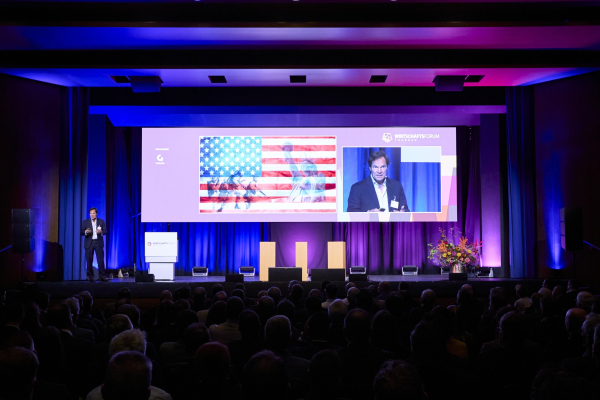Goldpreis setzt zu neuer Rallye an

Text: PD/stz.
«Die Wirtschaft in der Schweiz wächst kaum», stellte das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO in seinem Bericht über das zweite Quartal 2025 fest. Demnach ist das Sportevent bereinigte BIP der Schweiz im zweiten Quartal um 0,1 Prozent gewachsen. Im ersten Quartal hatte der Zuwachs noch 0,7 Prozent betragen.
In einem aktualisierten Konjunkturszenario wird – infolge der hohen US-Zölle – für 2026 ein schwächeres Wachstum der Schweizer Wirtschaft für 2026 erwartet. Zuletzt waren 1,2 Prozent für 2026 erwartet worden, jetzt geht man von nur noch 0,8 Prozent aus.
Der Handelskonflikt mit den USA führt zu Korrekturen bei den Schweizer Konjunkturprognosen.
Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich hat gegen Monatsende September ihre Prognose in der Herbstausgabe neuerlich nach unten revidiert. Für dieses Jahr bleibt man bei den vorausgesagten 1,4 Prozent BIP-Wachstum. Wegen der US-Zollpolitik und der internationalen Unsicherheit rechnet man für nächstes Jahr nur noch mit 0,9 Prozent Wachstum gegenüber den 1,5 Prozent, die man noch in der Sommerprognose in Aussicht gestellt hatte.
Hätte die Schweizer Wirtschaft dieselben Zölle zu den USA wie die EU, könnte die Wirtschaft 2026 um 1,2 Prozent und 2027 um 1,8 Prozent wachsen.
Aktuell sieht die Auswertung des Index KMU PMI der Raiffeisenbank mit 49,7 Punkten einen Rückgang unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Das ist der erste Rückgang seit März. Am deutlichsten ist der Auftragsbestand zwischen Juli und August um 3,3 Punkte zurückgefallen. Auch die Produktion schwächte sich um 1,2 Punkte ab.
Mehr als 40 Prozent der Schweizer KMUs die in den USA tätig sind, planen ihre Preise teilweise oder umfassend zu erhöhen. Mehr als die Hälfte der in die USA exportierenden Unternehmen rechnen mit einem moderaten oder starken Rückgang der Nachfrage nach Preiserhöhungen.
Der Schweizer Aussenhandel ist im zweiten Quartal deutlich zurückgegangen.
Die Exporte Schweizer Unternehmen nahmen im zweiten Quartal 2025 gegenüber dem ersten Quartal um 5,3 Prozent ab, die Importe sanken im gleichen Zeitraum um 7,1 Prozent. Die Exporte der chemisch-pharmazeutischen Produkte sanken um 9,6 Prozent.
Zugenommen haben in beiden Quartalen die Exporte von Uhren (+2,6%) und Maschinen- und Elektronik (+1,4%).
Uneinheitliches Wachstum in den Euroländern
In den einzelnen Euroländern entwickelte sich die Wirtschaft im laufenden Jahr bisher sehr unterschiedlich stellt, das Wiener Wirtschaftsforschungsinstitut fest. So schrumpfte die Wirtschaftsleistung in Deutschland beispielsweise im zweiten Quartal um 0,3 Prozent, nach einem starken Jahresauftakt im ersten Quartal mit 0,3 Prozent Plus.
Gleiches gelte für Italien, jedoch war dort der Rückschlag mit 0,1 Prozent Minus geringer. Spanien und Frankreich konnten hingegen im zweiten Quartal das Wachstum des Vorquartals übertreffen.
Gemäss dem Statistikamt der EU Eurostat stiegen die Konsumausgaben der privaten Haushalte im zweiten Quartal in der EU um 0,3 Prozent, im Euro-Raum um 0,1 Prozent. Die Konsumausgaben des Staates stiegen im Euro-Raum um 0,5 Prozent und in der EU um 0,7 Prozent. Die Brutto-Anlage-Investitionen sanken im Euro-Raum um 1,8 Prozent und in der EU um 1,7 Prozent.
Die Exporte sanken im Euro-Raum um 0,5 Prozent und in der EU um 0,2 Prozent. Die Importe bleiben im Euro-Raum unverändert und stiegen in der EU um 0,3 Prozent. Im Monat August ist in der EU die Inflation mit 2,4 Prozent gleichgeblieben. Im Euro-Gebiet beträgt die Steigerung 2,0 Prozent, ebenso unverändert.
USA erwartet Jahresinflation von 3 Prozent
Die lange erwartete Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am 17. September um 0,25 Prozent auf 4 bis 4,25 Prozent hat am amerikanischen Markt einige Bewegung ausgelöst. Die Konjunkturprognose wurde auf 1,6 Prozent angehoben, als Jahresinflation werden 3,0 Prozent erwartet. Die geplanten 2,0 Prozent werden somit wohl verfehlt.
Am 25. September bestätigte das Bureau of Economic Analysis im US-Handelsministerium die letzten Wirtschaftserhebungen. Demnach ist das BIP nach einem Rückgang um minus 0,6 Prozent im ersten Quartal des Jahres im zweiten Quartal um 3,8 Prozent gestiegen.
Auch interessant
In den Diskussionen um den Fed-Entscheid wollen manche Stimmen eine Präferenz für eine stärkere Zinssenkung, nämlich um 0,5 Prozent erkennen, im Oktober und Dezember werden jedenfalls weitere Zinssenkungen erwartet. Vor allem die Daten des Arbeitsmarktes scheinen Analysten zu denken zu geben, während die Frage der Zölle und ihre möglichen Auswirkungen auf die Inflation eher in den Hintergrund zu treten scheint.
Nach 4,2 Prozent zuletzt lauten jetzt die Prognosen auf 4,3 Prozent Arbeitslosenquote. Eine höhere Arbeitslosenquote würde zu Rückgang des Konsums führen. Sorgen bereitet manchen Anlegern auch die anhaltende Schwäche des US-Dollar.
Im August erreichte die Teuerung in den USA mit 2,9 Prozent einen Höchststand.
Die Inflationsrate ist in den USA im August neuerlich angestiegen und erreicht mit 2,9 Prozent den höchsten Stand seit Januar 2025 (+3,0%), nachdem sie im April auf 2,3 Prozent gefallen war und zuletzt im Juni und Juli 2,7 Prozent betragen hatte. Lebensmittel sind im August um 3,2 Prozent teurer geworden, die Preise für gebrauchte Autos und Lastwagen lagen um 6 Prozent höher als im Vorjahr.
Angestiegen sind wieder die Energiekosten (+0,2%). Der Preisrückgang bei Benzin und Heizöl nahm ab. Gegenüber Juli stiegen die Verbraucherpreise in den USA um 0,4 Prozent. Es ist der stärkste Monatsanstieg in diesem Jahr.
Nach Seitwärtsbewegung neue Goldpreis-Rallye
Nach einer Seitwärtsbewegung des Goldkurses bis etwa Mitte August haben die Märkte zunächst im Hinblick auf die Augustdaten der Wirtschaft und erste Zinsdiskussionen reagiert. Ende August stand der Goldpreis auf dem Rekordstand von 2'701.75 Franken je Feinunze. Je näher die Zinsentscheidung der Fed vom 17. September rückte, desto stärker stieg der Goldpreis. Zuletzt hat der «Shutdown» in den USA per Anfang Oktober den Wert des gelben Edelmetalls in die Höhe getrieben.
Für ein Ende der Aufwärtsbewegung gibt es wenige Anzeichen, im Gegenteil. Fast alle renommierten Beratungs- und Investmenthäuser sprechen von anhaltenden 3'600 bis 4'000 US-Dollar bis Jahresende als mögliche Entwicklung. Die Deutsche Bank sieht Möglichkeiten für den Goldpreis mit durchschnittlich 4'000 US-Dollar im Jahr 2026. Goldmann Sachs hält, abhängig von der zukünftigen Rolle der Fed in den USA 5'000 Dollar in Zukunft für denkbar.
Für die Zeit bis 2030 werden von manchen Wortmeldungen sogar bis zu 7'000 US-Dollar für möglich gehalten, und einzelne Analysten wie Ken Hoffman vom Minen Financier Red Cloud Securities halten sogar einen Anstieg bis zu 10'000 Dollar für denkbar.
Die Goldminen selbst verbuchen zuletzt sehr gute Geschäftsergebnisse. Als Hauptpreistreiber für den steigenden Goldpreis gilt die anhaltende Inflation, die sinkenden Zinsen, die Unstabilität der Weltpolitik und der Wirtschaftsentwicklung sowie die Schwäche des Dollars.
Alle renommierten Beratungs- und Investmenthäuser rechnen mit einem weiteren Anstieg des Goldpreises.
Gesteigerte Nachfrage der Schwellenländer und Unsicherheiten, was die chinesische Goldpolitik für Absichten hat, tragen dazu bei, dass kurzfristige Voraussagen immer schwieriger werden und Langfristprognosen schwer einzuschätzen sind.
Das World Gold Council erwartet jedenfalls in seinem Ausblick auf das zweite Halbjahr 2025 weiteres Aufwärtspotential für Gold-ETFs und eine mögliche Erholung der Nachfrage nach Gold für Schmuck, die im ersten Halbjahr wegen der Preisentwicklung gesunken war. Auch Einschränkungen bei der Technologienachfrage erwartet man nicht, hier scheinen die Preisentwicklungen keine Rolle zu spielen.
Apropos Technologie: Seit Jahrhunderten ringt der Mensch mit der Frage, ob er die Technik beherrscht oder von ihr beherrscht wird. Schon Goethes «Zauberlehrling» zeigt, wie ein nützliches Werkzeug zur unkontrollierbaren Macht werden kann – ein Sinnbild für die heutigen Ängste vor künstlicher Intelligenz. Mary Shelleys «Frankenstein» führt dieses Motiv weiter. Der Schöpfer verliert die Kontrolle über sein Werk, weil er dessen Folgen nicht bedenkt.
In der Moderne wird diese Spannung weitergesponnen – von «Metropolis» über «2001: Odyssee im Weltraum» bis zu «Black Mirror». Technik erscheint nicht mehr bloss als Werkzeug, sondern als Kraft, die menschliches Denken und Handeln formt. So bleibt das Verhältnis ambivalent: Der Mensch erschafft Technologie, doch mit jedem Fortschritt wächst ihre Macht über ihn – und die Frage, wer am Ende wem dient, bleibt offen.
Ich wünsche Ihnen eine Woche, in der Sie Herr über die von Ihnen genutzte Technologie bleiben.
Mit goldenen Grüssen
Christian Brenner
Zum Autor: Christian Brenner, Geschäftsführer Philoro Schweiz AG
Christian Brenner hat Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert und ist seit 2017 Geschäftsführer des inhabergeführten Familienunternehmens Philoro sowie Verwaltungsrat der Philoro Global Trading, der Philoro North America und der Philoro International Holding. Zuvor hatte er 2011 bis 2019 als Geschäftsführer der Philoro Edelmetalle GmbH in Deutschland agiert. Er ist zudem als Gastdozent an der Universität St.Gallen (HSG) tätig und Mitglied mehrerer Handelsausschüsse der IHK.