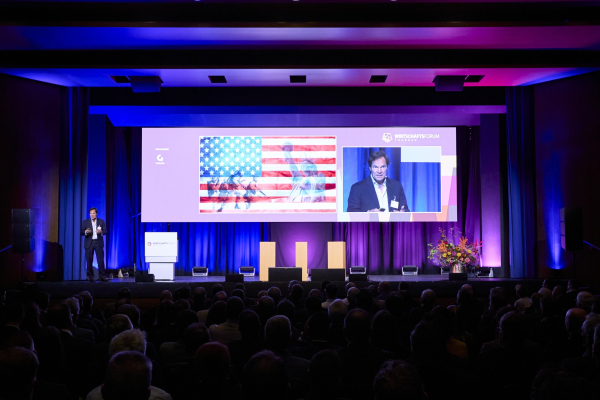Trumps Handelskonflikte führen zu mehr Investments bei Gold

Text: Christian Brenner, Geschäftsführer Philoro Schweiz AG
In der Schweiz haben die Unsicherheiten die Industrietätigkeit im März weiter gebremst. Im KMU-Portal des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO wird festgestellt, dass die Unternehmen durch die unklare Entwicklung vor allem im aussenwirtschaftlichen Bereich wieder zunehmend verunsichert seien. Dies findet auch in der jüngsten Prognose der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich seinen Niederschlag.
Die Konjunkturprognose der KOF sieht in ihrer letzten Publikation Ende März die Schweizer Wirtschaft in ihrer Frühjahrsprognose im «Spannungsfeld zwischen Handelskonflikt und Fiskalimpulsen». Ähnlich wie zuletzt die Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes erwartet man für dieses Jahr ein BIP-Wachstum von 1,4 Prozent, für 2026 dann 1,9 Prozent.
Das KMU-Portal der Schweizer Eidgenossenschaft verweist in seiner Veröffentlichung von Mitte April auf getrübte Konjunkturerwartungen. Der Einkaufsmanagerindex der Bank Raiffeisen sei im März auf 47,9 Punkte gesunken, nachdem er im Februar (49,9 %) noch knapp unter der Wachstumsschwelle gelegen sei. Alle Subkomponenten seien unter die 50 Prozent der Wachstumsschwelle gesunken. Aufgrund der weltweiten Unsicherheit hätten mehr als 60 Prozent der exportorientierten KMUs ihre Investitionstätigkeit reduziert.
Aufgrund der schwelenden Handelskonflikte trüben sich die Konjunkturerwartungen für die Schweiz.
Die Preisentwicklung in der Schweiz blieb gleichbleibend stabil. In der am 3. April veröffentlichten Publikation des Bundesamtes für Statistik wird für März wieder ein Anstieg der Verbraucherpreise von unverändert 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen.
Gestiegen seien die Preise für Pauschalreisen ins Ausland, für Zeitschriften-Abonnements und Bekleidung und Schuhe. Gesunken seien die Preise für Parahotellerie, die Mieten für private Verkehrsmittel sowie Preise für Treibstoff und Heizöl.
Europa kann Inflation nur schwerlich eindämmen
Im Euro-Raum ist die jährliche Inflation im März auf 2,2 Prozent gesunken (nach 2,3% im Februar und 2,4% im März des Vorjahres). Die Europäische Zentralbank EZB hat am 22. April eine Zusammenfassung der Umfragen unter professionellen Prognoseinstituten für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht.
So werden in Europa für 2025 2,2 Prozent Inflationsrate, für 2026 und 2027 2,0 Prozent erwartet. Das wären für dieses und das nächste Jahr um 0,1 Prozentpunkte mehr als zuletzt erwartet. Vor allem die Auswirkungen von Zöllen und Verteidigungsausgaben sind Hauptfaktoren für die Korrektur der Inflations- und Wachstumserwartungen, meint man bei den Experten der EZB.
Für 2025 wird ein reales Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,9 Prozent erwartet, nächstes Jahr sollen es dann 1,2 Prozent sein, 2027 soll das BIP um 1,4 Prozent wachsen. Damit sind die Erwartungen für dieses Jahr und nächstes Jahr um 0,1 Prozentpunkte nach unten korrigiert worden, während man für 2027 0,1 Prozentpunkte mehr als zuletzt erwartet. Die Arbeitslosenquote sollte im Euro-Raum 2025 bis 2027 6,3 Prozent betragen, dann auf 6,2 Prozent sinken.
Die Inflation, die weltweit eine Pause angelegt zu haben scheint, scheint nun ihren Tiefpunkt (noch über den gewünschten zwei Prozent) erreicht zu haben, und droht wieder mit Ausschlägen nach oben. Dementsprechend unklar ist die kommende Zinspolitik – vor allen in den USA, da die EZB ihre Zinsen bereits im März neuerlich gesenkt hatte. Nächster Termin des Federal Open Market Comites der US-Notenbank Fed ist Mitte Juni – wer weiss, was bis dahin geschieht – auch mit ihrem Vorsitzenden Jerome Powell, der sich den Missmut von Donald Trump zugezogen zu haben scheint.
Trump lanciert medienwirksam einen Zoll-Hammer
Mit einem medienwirksamen Auftritt Anfang April hatte US-Präsident Donald Trump neue Zölle für Handelspartner weltweit angekündigt. Importe aus der Europäischen Union sollten mit Aufschlägen von 20 Prozent belegt werden. Als «Mindestsatz» für andere Länder nannte der US-Präsident zehn Prozent. Für die Schweiz hatte Trump einen Zoll von 31 Prozent verhängt.
Damit schickte er die Aktienmärkte weltweit auf Talfahrt. Es folgten weitere Ankündigungen wie etwa, dass die Einfuhr chinesischer Waren mit 125 Prozent verzollt werden soll, oder dass Autos und Autoteile (ausser aus Kanada und Mexiko) zusätzlich mit 25 Prozent Zoll belegt werden. Gegen Ende April erholten sich die Aktienmärkte allmählich wieder. Die Lage bleibt angespannt.
Auch interessant
Der Internationale Währungsfonds hat die Prognose für die USA indessen deutlich nach unten korrigiert. In diesem Jahr soll das BIP um 1,8 Prozent wachsen (minus 0,9 Prozentpunkte), im kommenden um 1,7 Prozent (minus 0,4 Prozentpunkte). «Die Abwärtskorrektur ist das Ergebnis grösserer politischer Unsicherheit, Handelsspannungen und eines schwächeren Nachfrageausblicks angesichts eines langsamer als erwarteten Konsumwachstums», so der IWF.
Zu Jahresbeginn sei die Stimmung bei Verbrauchern, Unternehmen und Investoren noch optimistisch gewesen, das habe sich geändert. In seinem Bericht erhebt der Internationale Währungsfonds auch Bedenken vor einem deutlichen Wachstum der Internationalen Staatsverschuldung und verweist besonders auf Länder mit hohen Staatsdefiziten wie eben die USA, aber auch China und Indien.
Gold-Nachfrage im Investmentbereich steigt
Der Goldpreis hatte am 18. März erstmals die 3'000-Dollar-Marke pro Feinunze nach oben überschritten, knapp ein Monat später ein neuer Rekord: nämlich 3'500 US-Dollar am 22. April. Die weltweite Goldnachfrage stieg im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 1 Prozent auf 1'206 Tonnen. Dies zeigt die aktuelle Statistik der Branchenorganisation World Gold Council (WGC), die Ende April publiziert wurde.
Der wichtigste Wachstumstreiber war der Investmentbereich, gestützt durch einen kräftigen Anstieg der Zuflüsse in Gold-ETFs sowie eine anhaltend hohe Nachfrage nach Münzen und Barren. In der Schweiz lag der Bedarf nach Investmentprodukten im ersten Quartal bei 5,8 Tonnen. Das ist mehr als vier Mal so viel wie im Jahr zuvor (1,4 Tonnen). Laut World Gold Council suchten Anleger weltweit Zuflucht in Gold, um sich gegen die Bedrohung durch Handelskonflikte, anhaltende geopolitische Spannungen und Turbulenzen an den Aktienmärkten abzusichern.
Umsatzzahlen des Edelmetallhandelsunternehmens Philoro zeigen, dass der Kauf von Edelmetallen derzeit populärer ist als der Verkauf. In Zahlen ausgedrückt steigerte Philoro den Umsatz beim Verkauf der Anlageprodukte aus Edelmetallen im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr um 35,8 Prozent.
Demgegenüber nahm der Umsatz beim Ankauf um 6,8 Prozent ab. Unter dem Strich resultierte ein Umsatzplus von 23,4 Prozent. Die Anleger rechnen wohl mit einer weiteren Rallye beim Goldpreis. Grundsätzlich sollten Anleger bei Gold aber einen langfristigen Fokus haben. Der Zeitpunkt für Investitionen in Gold ist immer gut, denn auf lange Sicht steigt der Goldpreis immer, auch wenn es zwischendurch Phasen von Abwärtsbewegungen geben kann.
Im März kehrte viel Gold aus den USA in die Schweiz zurück, doch die weitere Entwicklung ist ungewiss.
Nachdem klar wurde, dass die USA keine Importzölle auf Gold erheben werden, ist der Export von Gold aus der Schweiz in die USA im März um 32 Prozent auf 103,2 Tonnen gefallen. Re-Importe von Gold aus den USA sind mit 25,5 Tonnen fast doppelt so hoch gelegen wie im Februar (12,1 Tonnen) und erreichten damit den höchsten Stand seit 13 Monaten.
Aus Sicht von Philoro ist die Schweiz insbesondere wegen der politischen und wirtschaftlichen Stabilität sowie der weitgehenden Neutralität auf dem internationalen Parkett ein attraktives Land für die Lagerung von Gold. Allerdings wird ein Teil des in die Schweiz zurückgekehrten Goldes wohl bald wieder exportiert. Es wird in den Schweizer Raffinerien teilweise in andere Barrengrössen verarbeitet und in andere Destinationen weitergeleitet. Wie sich die Handelsstatistik weiterentwickelt, bleibt abzuwarten.
Apropos Statistik: In der kleinen US-Stadt Talkeetna des Bundesstaates Alaska wurde 1997 aus Protest gegen die Politik ein Kater namens «Stubbs» per statistischer Zufallswahl zum Bürgermeister gewählt. Wie kam es dazu? Die Einwohner waren frustriert von den menschlichen Kandidaten und trugen den Namen des Katers in die Wahlzettel ein – aus reiner Ironie wohlgemerkt. Stubbs bekam dank einer statistischen Streuung der Proteststimmen tatsächlich die Mehrheit.
Er erhielt damit natürlich kein echtes politisches Amt, aber: Stubbs blieb über 20 Jahre das inoffizielle Stadtoberhaupt, wurde in jeder Tourismusbroschüre erwähnt und statistisch gesehen hatte er eine bessere Zustimmungsrate als jeder echte Politiker im Bundesstaat. Als er starb, analysierten mehrere Zeitungen ernsthaft die «Amtszeit» des Katers und kamen zu dem Schluss: «Keine Korruption, keine Skandale, 100 Prozent Schnurren – statistisch der erfolgreichste Bürgermeister Alaskas.»
Ich wünsche Ihnen eine Woche, in der Sie beweisen, dass man nicht in der Mehrheit sein muss, um Wirkung zu zeigen – denn auch Ausreisser verändern den Durchschnitt.
Mit goldenen Grüssen
Christian Brenner
Zum Autor
Christian Brenner, Geschäftsführer Philoro Schweiz AG
Christian Brenner hat Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert und ist seit 2017 Geschäftsführer des inhabergeführten Familienunternehmens Philoro sowie Verwaltungsrat der Philoro Global Trading, der Philoro North America und der Philoro International Holding. Zuvor hatte er 2011 bis 2019 als Geschäftsführer der Philoro EDELMETALLE GmbH in Deutschland agiert. Er ist zudem als Gastdozent an der Universität St.Gallen (HSG) tätig und Mitglied mehrerer Handelsausschüsse der IHK.