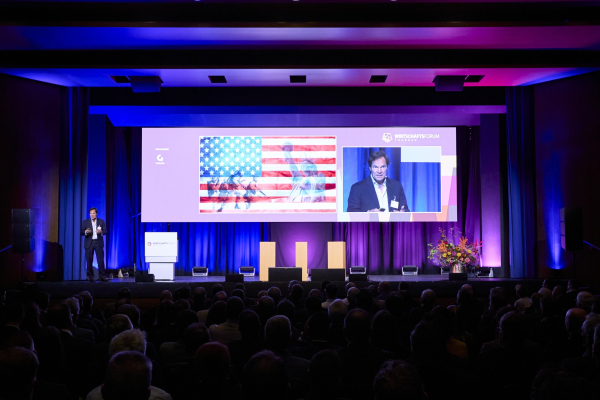Technologie als Treiber für eine nachhaltige Ernährungswirtschaft

Text: pd/stz.
«Unsere Thurgauer Landwirtschaftsbetriebe investieren viel in die nachhaltige Produktion und sind dankbar, wenn die Hochschulen technische Lösungen entwickeln», betonte der Thurgauer Regierungsrat Walter Schönholzer in seiner Begrüssung zum sechsten Innovationsforum Ernährungswirtschaft in Tänikon.
«Verschiedene Betriebe sind heute hier und erhalten Impulse, um neue Systeme in ihren Produktionsprozess aufzunehmen.» Diese Feststellung von Walter Schönholzer widerspiegelt das Ziel des Innovationsforums Ernährungswirtschaft: den Wissens- und Technologietransfer zugunsten der gesamten Wertschöpfungskette von Lebensmitteln zu fördern.
Nach fünf erfolgreichen Durchführungen durch das Innovationsboard Tänikon des Kantons Thurgau wurde das Innovationsforum Ernährungswirtschaft an das ISF Institut für Intelligente Systeme und Smart Farming der OST – Ostschweizer Fachhochschule unter der Leitung von Prof. Dr. Dejan Šeatović übergeben.
Gemeinsam mit Agroscope und der Swiss Future Farm schafft das ISF seither eine Plattform für den Austausch zu praxisnahen Themen der innovativen Land- und Ernährungswirtschaft. In diesem Jahr stand das Thema «Technologie, ein Weg zur nachhaltigen Ernährungswirtschaft?!» im Fokus.
Klimaneutrale Landwirtschaft
Ein Blick in die globale Ernährungswirtschaft führt unweigerlich zu Nestlé, dem grössten Lebensmittelkonzern der Welt. Daniel Imhof, Leiter der landwirtschaftlichen Angelegenheiten von Nestlé Schweiz, zeigte sich überzeugt, dass die Landwirtschaft langfristig klimaneutral werden kann. «Aus meiner Sicht ist die Landwirtschaft der einzige Bereich, in dem Treibhausgase wirtschaftlich aus der Atmosphäre entfernt werden können – und zwar in einer Win-win-Situation», erklärte er.
Eine zentrale Rolle spielt dabei die landwirtschaftliche Sequestrierung – die Speicherung von CO₂ im Boden. Dieses Prinzip verfolgt auch das Projekt «AgroImpact», das Nestlé gemeinsam mit WWF im Kanton Waadt betreibt, um Emissionen auf Bauernhöfen zu reduzieren und die CO₂-Speicherung zu fördern. Solche Initiativen sollen dazu beitragen, dass Nestlé bis 2050 das Netto-Null-Ziel erreicht.
Zur nachhaltigen Transformation tragen in der Schweiz auch Labelorganisationen wie IP-Suisse bei. Mit rund 18'000 Mitgliedern und 10'000 Label-Produzenten zählt sie zu den bedeutendsten Produzentenorganisationen des Landes. Seit 2021 verpflichtet IP-Suisse ihre Betriebe mit einem «Klimapunktesystem». «Ziel ist es, die Klimawirkung der Produktion zu erfassen – ohne dass die Landwirte umfangreiche Daten erfassen müssen», erläuterte Geschäftsführer Christophe Eggenschwiler.
Das sei ein zentraler Faktor bei der Entwicklung des Online-Tools des Klimapunktesystems gewesen: Die Produzenten nicht zusätzlich mit administrativer Arbeit zu belasten. Christophe Eggenschwiler zieht Bilanz: «Die Resonanz unserer Mitglieder auf das Tool ist positiv ausgefallen – wir haben sogar 700 proaktive Vorschläge der Bauern für Klimamassnahmen erhalten.»
Globale Ernährungs(un)sicherheit
Die Frage nach der Nachhaltigkeit ist eng mit jener nach der globalen Versorgungssicherheit verknüpft. «Bis 2050 wird die Nachfrage nach Lebensmitteln um 50 Prozent steigen», zitierte Prof. Dr. Henrik Nordborg, Studiengangleiter Erneuerbare Energien und Umwelttechnik an der OST, eine Studie von 2019.
«Wir haben keine Ahnung, wie das funktionieren soll.» Die dafür benötigte Ackerfläche entspräche der doppelten Fläche Indiens. Henrik Nordborg betonte, dass sich die Produktion von Nahrungsmitteln für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen marktwirtschaftlich kaum lohnt – weshalb finanzielle Anreizsysteme nötig seien, um eine Grundversorgung sicherzustellen.
Während heute rund 700 Millionen Menschen auf der Welt Hunger leiden, verzeichnet die Schweiz pro Jahr rund 2.8 Millionen Tonnen Lebensmittelverluste. Eine, die diese bedrückende Realität nicht hinnehmen will, ist Olivia Menzi. Sie ist Geschäftsführer von Circunis, einem digitalen Marktplatz für Lebensmittelüberschüsse.
Auf der Plattform warten aktuell fast 90 Tonnen überschüssige Waren aus Verarbeitungs- und Produktionsbetrieben darauf, wieder in den Kreislauf zurückzukommen. «Unsere Vision ist eine Schweiz, die verwendet, was da ist – statt auf Kosten von Umwelt und Gesellschaft zu wirtschaften», betonte Olivia Menzi.
Auch interessant
Mit Laser, Heisswasser und Strom gegen Unkraut
Wie modernste Technologien in der Landwirtschaft getestet oder bereits eingesetzt werden, zeigte der Schwerpunkt des Innovationsforums Ernährungswirtschaft zu robotischen Lösungen. Daniel Vetterli von der Vetterlifarm setzt im Biozuckerrüben-Anbau seit 2020 auf den FarmDroid-Roboter, der die Zwischenräume der Pflanzen autonom jätet. «Das spart bis zur Hälfte der Handarbeit», erklärte er. Handjäten ist in der Biolandwirtschaft, wo keine Pestizide erlaubt sind, immer noch nötig.
«Handjäten ist aber mit hohen Kosten und Personalmangel verbunden», sagte Radek Zenkl. Deshalb setzt das ETH-Spin-off Caterra, bei dem er als CTO tätig ist, auf Laser statt auf Handarbeit. Der batteriebetriebene Roboter von Caterra navigiert voll autonom per GPS durch das Feld und beseitigt Unkraut mit Laserstrahlen. Ein Deep-Learning-Algorithmus erlaubt es ihm, zwischen Nutzpflanzen, Unkraut und Erde zu unterscheiden.
Nach diesem Prinzip arbeitet auch Prof. Dr. Katrin Lohan, Institutsleiterin des EMS Instituts für Entwicklung Mechatronischer Systeme der OST, an einem modularen Roboter namens OFA – kurz für Open Field Automation. OFA entfernt Unkraut – spezifisch Blacken – mit Heisswasser oder Stromstössen. Damit der Roboter weiss, wo die Blacken sind, wird das Feld zuvor mit einer Drohne abgeflogen und mit KI-Bilderkennung die Schädlinge detektiert.
Ob Laser, Strom oder Heisswasser – alle Methoden bergen Potenzial, den Einsatz von Pestiziden künftig stark zu reduzieren. «Wahrscheinlich werden sich die verschiedenen Techniken ergänzen», betonte Radek Zenkl.
Von Vertical Farming bis zum Mähroboter
Neben dem OFA-Roboter präsentierten die Sponsoren und Partner des Innovationsforums eine breite Palette weiterer Technologien. Das Start-up Frugal Tec aus Diepoldsau stellte seine Vertical-Farming-Anlagen vor. Zudem war der autonome Mähroboter amea, der in Zusammenarbeit mit der OST entwickelt wurde, vor Ort. Das ISF zeigte unter anderem den hundeähnlichen Roboter ANYmal, mit dem aktuell experimentiert wird.
Das nächste Innovationsforum Ernährungswirtschaft findet am 24. November 2026 in Tänikon statt.