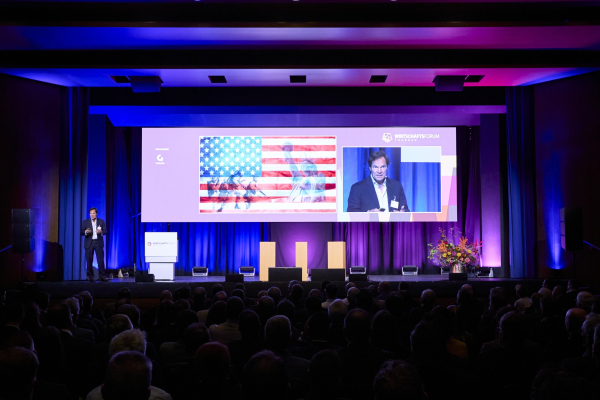Rauer Gegenwind für die Ostschweizer Exportindustrie trotz tieferer US-Zölle

Text: pd/stz.
Die Ostschweizer Industrie ist herausgefordert. Die durchschnittliche Auslastung der Produktionskapazitäten liegt mit knapp 80% unter dem üblichen Niveau, die Auftragslage bleibt angespannt. 44% der Ostschweizer Industrieunternehmen berichten derzeit von einer ungenügenden Auftragslage.
Nachfrageschwäche aus Deutschland belastet
Die grösste Herausforderung für die hiesige Industrie ist weiterhin die Nachfrageschwäche aus Deutschland. Der wichtigste Absatzmarkt der Ostschweizer Exportwirtschaft – auf ihn entfällt rund ein Drittel aller Warenausfuhren – kämpft weiter mit rückläufiger Industrieproduktion, sinkenden Privatinvestitionen und nachlassender Wettbewerbsfähigkeit. Dies belastet insbesondere in der Ostschweiz ansässige Automobilzulieferer, die stark von Deutschland abhängig sind.
In den USA, dem zweitwichtigsten Absatzmarkt, entwickelt sich die Wirtschaft zwar robuster als noch im Sommer befürchtet. «Allerdings zeigen sich auch in den USA vermehrte Anzeichen einer wirtschaftlichen Abkühlung», erklärt Thomas Stucki, Chief Investment Officer der St.Galler Kantonalbank.
US-Zölle: Entschärfung, aber weiterhin belastend
Zusätzlich zur schwächeren Auslandsnachfrage belasten die US-Importzölle die Ostschweizer Exportindustrie – auch nach deren Reduktion auf 15%. Die Einigung mit den USA schafft zwar gleich lange Spiesse gegenüber der Konkurrenz aus der EU und Japan. Doch Thomas Stucki betont: «Das Zollniveau ist weiterhin hoch. Zusätzlich belastet die Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken um über 10% seit Jahresbeginn die Wettbewerbsfähigkeit.»
Der Grossteil der Schweizer Produkte ist auf dem US-Markt damit weiterhin rund 25% teurer als noch Anfang Jahr. IHK-Chefökonom Jan Riss ergänzt: «Neben den direkten Auswirkungen auf die Exporte machen sich die US-Zölle auch weiterhin indirekt bemerkbar. Die geringere Nachfrage für Vorleistungen aus Europa und die gestiegene globale Unsicherheit belasten die Ostschweizer Industrie.»
Im aktuellen Umfeld werden öfters Investitionen zurückgestellt, was die in der Ostschweiz stark vertretene Maschinenindustrie besonders trifft. Insgesamt sind die Ostschweizer Warenexporte seit den Zollankündigungen Anfang April gegenüber der Vorjahresperiode um 3.2% eingebrochen – jene in die USA gar um 11.5%. Im gesamtschweizerischen Vergleich ist dieser Rückgang überdurchschnittlich gross. Die vorgezogenen Exporte im ersten Quartal aufgrund antizipierter Zölle fielen in der Ostschweiz zudem deutlich geringer aus.
Ostschweizer Industrie zeigt sich resilient
Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen beweisen die Ostschweizer Unternehmen einmal mehr ihre Widerstandsfähigkeit. Nachdem sich die Stimmung im August deutlich eingetrübt hatte, scheint sich die Industrie inzwischen besser mit der anspruchsvollen Situation arrangiert zu haben.
«Zuletzt hat sich das Stimmungsbild leicht aufgehellt, wenn auch ausgehend von tiefem Niveau und vor allem erwartungsgestützt», erläutert Jan Riss. So wird zum Beispiel wieder eine leichte Zunahme der Bestellungen erwartet. «Besonders in der Elektronik- und Optikbranche sowie im Maschinen- und Fahrzeugbau zeigen sich die Unternehmen etwas zuversichtlicher», präzisiert Jan Riss.
Den Unternehmen fällt es allerdings weiterhin schwer, die künftige Geschäftsentwicklung zuverlässig einzuschätzen. Knapp zwei Drittel berichten von einer überdurchschnittlich hohen Unsicherheit. Insgesamt bleibt die Lage herausfordernd. Daran dürfte sich auch im kommenden Jahr wenig ändern. Das Wachstum in den wichtigsten Absatzmärkten der Ostschweizer Industrie wird voraussichtlich auch 2026 unter dem langfristigen Durchschnitt bleiben.
«In Deutschland könnte das Infrastrukturpaket ab 2026 zwar erste Impulse setzen, die strukturellen Probleme der deutschen Industrie dürften jedoch bestehen bleiben», so Thomas Stucki. Wesentliche Impulse für eine nachhaltige Erholung in der Ostschweizer Industrie sind daher in den kommenden Monaten nicht zu erwarten.
Arbeitslosigkeit steigt leicht, aber Arbeitsmarkt weiter robust
Die Industrieunternehmen berichten aufgrund der schwachen Nachfrage zunehmend auch von personellen Überkapazitäten. Vermehrt setzen die Unternehmen zur Überbrückung der Nachfrageschwäche auf Kurzarbeit. Trotzdem sind aber auch Entlassungen teils nicht zu vermeiden. Noch im Sommer 2023 hatte die Arbeitslosenquote in der Ostschweiz mit 1.4% den tiefsten Stand der letzten Jahre erreicht. Seither hat sie sich schleichend auf 2.1% erhöht.
Alarmierend ist die Situation gemäss Jan Riss aktuell jedoch nicht: «Der Anstieg signalisiert zwar eine Abkühlung. Die Quote liegt aber weiterhin knapp unter dem langjährigen Durchschnitt.» Arbeitssuchende finden zumeist rasch eine neue Beschäftigung – ein klares Signal für die weiterhin robuste Lage am Arbeitsmarkt.
Auch interessant
Privater Konsum stützt, verliert aber an Dynamik
«Die binnenorientierten Branchen stützen weiterhin die Gesamtwirtschaft», erklärt Jan Riss. Sie blieben von den Unsicherheiten rund um die US-Zölle und den verhaltenen Arbeitsmarktaussichten aber nicht ganz verschont: «Zuletzt hat sich die Einschätzung der Arbeitsplatzsicherheit eingetrübt, was zu einer gewissen Zurückhaltung beim Konsum führt.»
Folglich büsst der private Konsum trotz steigender Reallöhne leicht an Dynamik ein und wirkt weniger stimulierend. Trotzdem rechnen sowohl das Gastgewerbe als auch der Detailhandel mittelfristig mit einer weitgehend stabilen Entwicklung.
Baugewerbe profitiert von tiefen Zinsen und reger Wohnbautätigkeit
Zuversichtlich zeigt sich das Ostschweizer Baugewerbe. Nach einem Dämpfer im Sommer schätzen die Ostschweizer Bauunternehmen ihre Geschäftslage wieder deutlich positiver ein. Im vergangenen Quartal hat sich die Bautätigkeit laut Unternehmensangaben konstant entwickelt. Im Bauhauptgewerbe wird sogar von einer überdurchschnittlichen Auftragsreichweite berichtet.
«Die Bautätigkeit wird durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum und die tiefen Zinsen getragen», so Thomas Stucki. Die Baubewilligungen deuten auf eine weiterhin rege Bautätigkeit im Wohnsegment hin. Im Baunebengewerbe dürfte die Abschaffung des Eigenmietwerts mittelfristig zu Vorzieheffekten und temporären Mehraufträgen führen. Bislang schlägt sich dies jedoch noch nicht in den Auftragsbüchern nieder.
Das Konjunkturboard Ostschweiz beurteilt quartalsweise die konjunkturelle Entwicklung der Ostschweizer Wirtschaft. Basis dafür bilden die regelmässigen Konjunkturumfragen in Zusammenarbeit mit der Konjunkturforschungsstelle (KOF Institut) der ETH Zürich. Aus den Ostschweizer Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden nehmen in der Regel zwischen 700 und 800 Betrieben an den Umfragen teil.
Das Konjunkturboard setzt sich wie folgt zusammen: Vonseiten der IHK St.Gallen-Appenzell aus Jan Riss, Chefökonom, sowie Fabio Giger, stellvertretender Leiter Research, und vonseiten der St.Galler Kantonalbank aus Céline Koster, Konjunkturexpertin, sowie Roman Elbel, Konjunkturexperte. Die Ökonomin und die drei Ökonomen kommentieren quartalsweise die Konjunkturlage in der Ostschweiz und bringen diese in den nationalen und globalen Kontext. Ergänzt wird das Gremium um Jérôme Müggler, Direktor IHK Thurgau, Karin Jung, Leiterin Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St.Gallen, Daniel Lehmann, Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Appenzell Ausserrhoden, sowie Thomas Reinhard, Leiter Projekte und Wirtschaftsfragen Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Thurgau.
Diese breite Kombination bündelt verschiedene Kompetenzen und ermöglicht eine ganzheitliche sowie konsistente Einschätzung zur konjunkturellen Entwicklung in der Region.
Die Resultate und Analysen der aktuellen Umfrage können interaktiv auf der Plattform www.konjunkturboard.ch abgerufen werden.