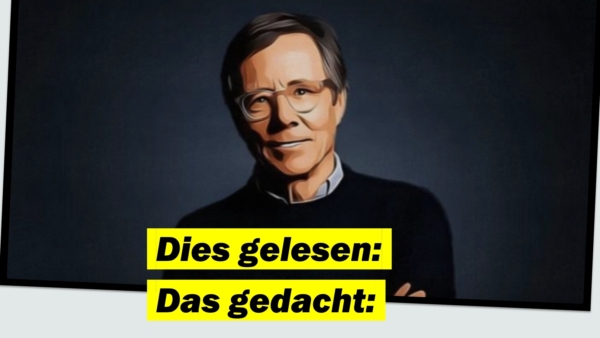«Die Eidgenossenschaft als Staatsidee hat Zukunft»
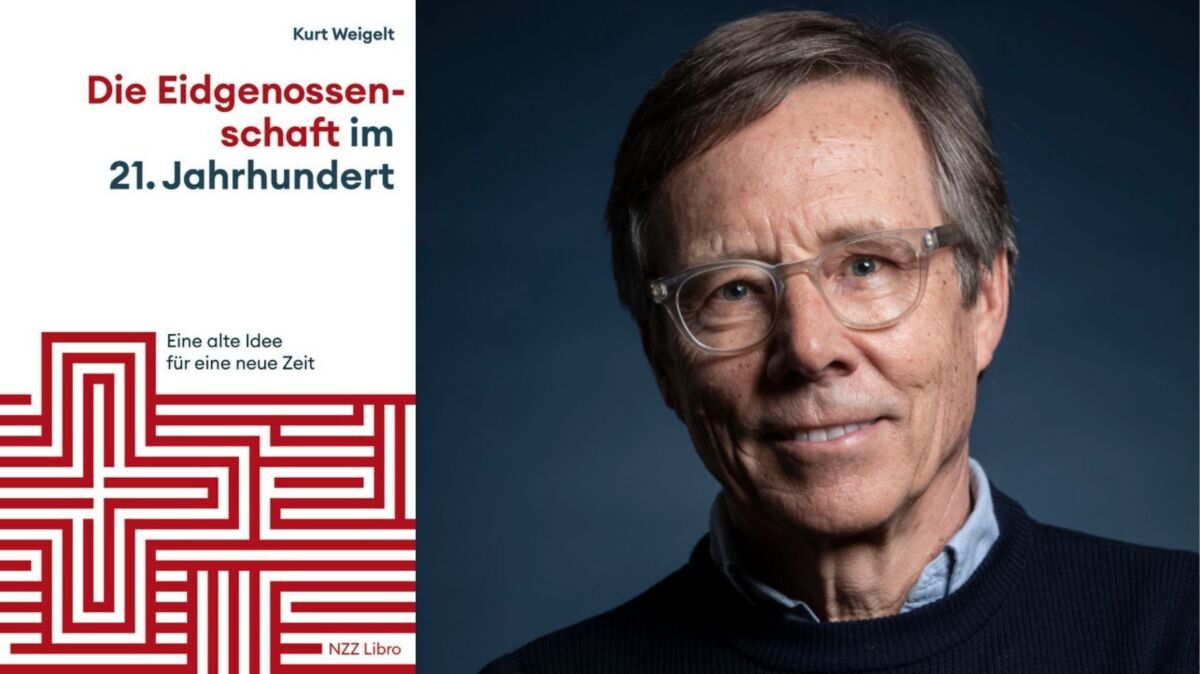
Text: Stephan Ziegler
Kurt Weigelt, in den letzten Jahren ging es in Ihren Publikationen regelmässig um die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der digitalen Gesellschaft. Ihr aktuelles Buch setzt sich nun aber mit der Eidgenossenschaft als Staatsidee auseinander. Haben Sie vom Vorwärtsgang in den Rückwärtsgang umgeschaltet?
Nein, überhaupt nicht. Auch in meinem aktuellen Text gehe ich der Frage nach, was die digitale Revolution für unsere Institutionen bedeutet – in der Überzeugung, dass neue Zeiten neue Antworten brauchen.
Was macht denn nach Ihrer Ansicht diese «neue Zeit» so besonders?
Die Digitalisierung, aber auch die Globalisierung und die Migration bewirken eine zunehmende Ausdifferenzierung sozialer Beziehungen. Die immer wieder beklagte Fragmentierung aller Lebensbereiche ist nicht das Problem, sondern das Wesen der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Fragmentierte soziale Strukturen treten an die Stelle einer bisher zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung hochgehaltenen Einheitlichkeit von Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt.
Das tönt nun aber etwas sehr theoretisch. Was bedeutet das in der Praxis?
Der Versuch, die Unsicherheiten einer sich verändernden Welt mit immer mehr Vorschriften und Kontrollen, mit dem Ausbau der öffentlichen Verwaltung und staatlich finanzierten Programmen in den Griff zu bekommen, scheitert an der Komplexität einer fragmentierten Gesellschaft. Dies zeigen die allgegenwärtigen politischen Krisen, die explodierenden Staatsschulden und der Vertrauensverlust in die politischen Institutionen. Verschiedenheit lässt sich nur mit Verschiedenheit bewältigen.
Und was hat das alles mit der Eidgenossenschaft als Staatsidee zu tun?
Das politische System der Schweiz ist seit jeher auf die Bewältigung von Verschiedenheit ausgerichtet. Grundlage des nationalen Bewusstseins ist die mit dem Begriff der «Willensnation» umschriebene freiwillige Gemeinschaft von Bürgern unterschiedlicher Herkunft. Diese besondere politische Kultur zeigt sich unter anderem in der direkten Demokratie, im Föderalismus und im Milizsystem. Das genossenschaftliche Staatsverständnis macht den Sonderfall und das Erfolgsmodell Schweiz aus.
Das Buch «Die Eidgenossenschaft im 21. Jahrhundert – Eine alte Idee für eine neue Zeit» ist in allen Buchhandlungen und als E-Book erhältlich. Verlag NZZ libro.
Wird hier nicht ein Mythos beschworen, der wenig mit der Realität zu tun hat?
In der Tat. Das genossenschaftliche Staatsverständnis hat in der jüngeren Zeit viel von seiner Kraft verloren. Die Forderung nach materieller Gleichheit verdrängt den Grundsatz der Chancengleichheit. Selbsthilfe ist für viele zu einem Fremdwort geworden. Das Parlament und die Verwaltung in Bundesbern bestimmen die politische Entwicklung. Die grosse Zahl von Berufspolitikern und Staatsangestellten stellt das Milizsystem in Frage. Internationale Verpflichtungen und die Annäherung an die Europäische Union belasten die direkte Demokratie.
Welche Folgen hat diese Entwicklung für die Zukunft der Schweiz?
Wir verspielen staatspolitische Alleinstellungsmerkmale, die in besonderem Masse zukunftstauglich sind. Ein von unten nach oben aufgebautes Gemeinwesen ist weit besser auf die Herausforderungen einer fragmentierten Gesellschaft vorbereitet als zentralverwaltete politische Systeme. Die Eidgenossenschaft als Staatsidee hat Zukunft. Die Schweiz tut gut daran, sich ihrer traditionellen Werte zu besinnen – und dies nicht mit einem verklärten Blick in den Rückspiegel. Vielmehr geht es darum, die politischen Institutionen der Schweiz auf die neue Zeit einzustellen.
Mir scheint aber, dass wir auf allen Ebenen der Politik in einem Reformstau stecken. Sehen Sie das anders?
Nein. Bereits Machiavelli wusste, dass der grösste Feind der neuen Ordnung ist, wer aus der alten seine Vorteile zog. Dies gilt ganz besonders für staatliche Leistungen mit Umverteilungscharakter. Immer gibt es Sieger und Verlierer. Was es braucht, sind im Grundsatz einfache, in ihren Konsequenzen aber tiefgreifende Veränderungen. Dazu gehören für mich die monistische Staatsfinanzierung, das partielle Budgetreferendum auf Bundesebene und eine ökonomische Steuerreform.
Angesprochen haben Sie die Annäherung an die eu. Wo sehen Sie hier die besonderen Herausforderungen?
Das Staatsverständnis der Schweiz und das Staatsverständnis der Europäischen Union sind nicht kompatibel. Die mit den Bilateralen III angedachte dynamische Rechtsübernahme und die Stellung des Europäischen Gerichtshofs bei Streitigkeiten stehen im Widerspruch zum genossenschaftlichen Staatsverständnis der Schweiz. Selbstverständlich kann man die Ansicht vertreten, dass in Zeiten von Digitalisierung, Globalisierung und Migration kein Weg an einer weitgehenden Integration in supranationale Machtblöcke vorbeiführt. Wer so argumentiert, benötigt allerdings bessere Argumente als rein wirtschaftliche Interessen. Es braucht eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem politischen Wertesystem der Schweiz. Mit meinem Buch möchte ich einen Beitrag zu dieser Diskussion leisten.