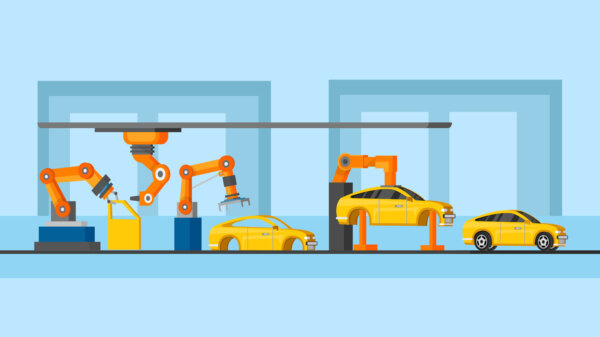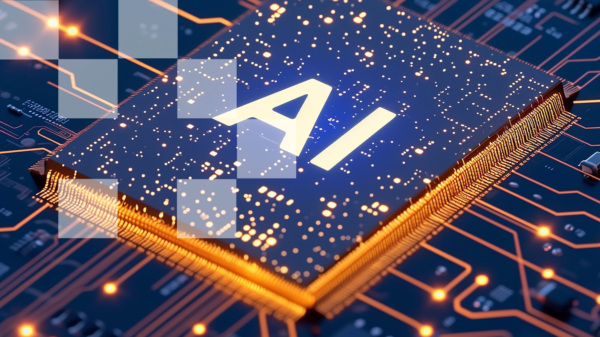«PowerPoint-Beratung reicht nicht»

Michael Pertek, Pascal Nüesch, was ist Ihr grösster Kritikpunkt an der Beraterbranche?
MP: Dass der Fokus der Beratung in IT-Projekten oftmals nicht auf der Wertschöpfung für den Kunden liegt, sondern auf dem eigenen Umsatz. Es werden kurzfristige oder nicht entsprechend evaluierte Softwarelösungen verkauft. Die Berater konzipieren etwas, beziehen ihr Honorar und sind wieder weg, bevor sich zeigt, ob die Lösung wirklich funktioniert, nachhaltig ist und in den Unternehmensalltag passt.
Sie sprechen die fehlende Nachhaltigkeit an. Wie äussert sich das konkret?
PN: Es fehlt an Tiefe. Viele Berater kommen in Technologiefragen mit einem theoretischen «Best Practice»-Ansatz, der auf einer Softwarelösung basiert. Aber sie kennen die Technologien und Alternativen nicht im Detail und wissen selten, was es für das Umsetzungsprojekt bedeutet und welche Auswirkungen es auf das Unternehmen hat. Man bekommt eine schöne PowerPoint-Präsentation mit beeindruckenden Grafiken, die sich im echten Leben nur schwer oder teuer umsetzen lässt.
Warum ist Ihnen die Einbindung der internen Teams so wichtig?
MP: Wir können die Zukunft eines Unternehmens nicht ohne seine eigenen Mitarbeiter gestalten. Ein Berater kann ein Konzept liefern, aber nur die Angestellten wissen, wie die Prozesse wirklich funktionieren und wo die wahren Herausforderungen liegen. Wenn sie nicht von Anfang an Teil des Lösungsweges sind, fühlen sie sich übergangen und die Ergebnisse sind unvollständig. Die Folge: fehlende Akzeptanz und aktiver Widerstand. Eine erfolgreiche Transformation braucht die Leute, die am Ende mit den neuen Systemen arbeiten müssen.
«Digitale Transformation scheitert nicht an Technik, sondern an nutzlosen Leuchttürmen.»
Das klingt, als hätten Sie schlechte Erfahrungen gemacht. Wie sollte eine gute Beratung stattdessen aussehen?
PN: Ein guter Berater ist kein externer Lehrer, sondern Coach und Partner. Er ist Experte und hoffentlich mehr als einen Schritt voraus, aber mit Kommunikation auf Augenhöhe. Er bringt nicht die eine fertige Lösung, sondern hilft dabei, zusammen die beste Lösung zu finden, die zur Firmengrösse, zu den Werten, zu den Zielen – und ganz wichtig – auch zum Budget passt.
Viele Unternehmen suchen aber Berater, um ihre digitale Transformation zu stemmen. Was läuft Ihrer Meinung nach dabei oft schief?
MP: Der grösste Fehler ist, dass die Beratungswelt zu oft wie ein Verkäufer agiert: Man bekommt nicht die beste Lösung, sondern schlimmstenfalls die Lösung, für die der Berater eine Partnerschaft oder eine Provision hat. Der sogenannte «Vendor Lock-in» ist ein riesiges Problem. Anstatt die wirklich passende Technologie auszuwählen, wird dem Kunden ein System empfohlen, das vielleicht nur die zweitbeste Wahl ist, aber dem Berater nützt.
PN: Ein weiterer Punkt ist die Ausrichtung des Vorgehens am vorhandenen Budget. Viele Berater kommen mit ihrem fixen Vorgehen, verbrauchen dadurch im Verhältnis zum Gesamtbudget zu viele Ressourcen. Das heisst, der Kunde hat schlussendlich ein eindrückliches Konzept, aber zu wenig Geld für die tatsächliche Umsetzung. Schöne Beispiele gibt es da aus dem bundesnahen Umfeld, wo man keine Rücksicht nimmt, weil irgendwoher ja immer wieder Budget organisiert wird.
Und wie positioniert sich Ihr Unternehmen hier anders?
MP: Wir versuchen nicht, ein fixes Vorgehen durchzudrücken, sondern finden in einer schlanken Analysephase heraus, wo der Schuh tatsächlich drückt, und definieren Fokuspunkte, damit das vorhandene Budget zielgerichtet investiert werden kann. Zudem sind wir komplett unabhängig. Unsere Loyalität gilt dem Kunden und seinen Zielen. Wir alle kennen das Dienstleistungsgeschäft auf der Umsetzungsseite und sind erfahrene Software-Architekten, Berater und Projektleiter.
PN: Wir haben Projekte von Grund auf aufgebaut und wissen, welche Technologien bzw. Produkte wirklich skalieren und welche nur auf dem Papier gut aussehen. Wir haben in Projekten sowohl gute als auch weniger gute Ergebnisse erlebt – und für beides Verantwortung getragen. Ein paar «blutige Nasen» haben uns eindrücklich gezeigt, wie entscheidend Kundeneinbezug, offener Diskurs über die richtige Lösung und die Wahl der passenden Software sind.
«Transformation gelingt nur mit den Mitarbeitern, die die Systeme nutzen.»
Das heisst, Sie schliessen die Lücke zwischen Strategie und Umsetzung?
MP: Genau. Der klassische Berater kommt mit einem Konzept, das oft von der Realität des Kunden losgelöst ist. Die PowerPoint-Architektur sieht wunderschön und zielführend aus, bricht aber in der Praxis zusammen. Unsere Architekten denken anders: Sie entwerfen eine Lösung, die nicht nur strategisch sinnvoll, sondern auch technisch umsetzbar ist.
Und wie stellen Sie sicher, dass das Wissen beim Kunden bleibt und nicht mit Ihnen geht, wenn das Projekt beendet ist?
PN: Wir sehen uns als Enabler. Unser Ziel ist es, die internen Teams des Kunden so stark zu machen, dass sie uns irgendwann nicht mehr brauchen oder für andere Aufgaben einsetzen. Das klingt paradox für ein Beratungsunternehmen, ist aber die einzige Art, nachhaltig zu arbeiten. Wenn wir gehen, hat das Team nicht nur eine funktionierende Lösung, sondern auch die Fähigkeiten, diese anzuwenden und weiterzuentwickeln.
Die Lebenszyklen von Software werden immer kürzer. Wie können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Investitionen nicht in wenigen Jahren veraltet sind?
MP: Das ist der entscheidende Punkt. Ein Unternehmen sollte nicht mehr in ein einziges, monolithisches Softwareprodukt investieren. Die Technologie entwickelt sich so schnell, dass eine Lösung, die heute State of the Art ist, morgen schon nicht mehr den Anforderungen genügt. Wir sehen uns als Architekten, die ein Haus bauen, dessen einzelne Räume oder Wände jederzeit modifiziert werden können, ohne die gesamte Struktur einzureissen.
PN: Das bedeutet, wir entwerfen modulare, auf Interoperabilität ausgelegte Architekturen mit offenen Schnittstellen. So können veraltete Komponenten ausgetauscht werden, ohne das gesamte System neu aufsetzen zu müssen.
Auch interessant
Wenn Sie mit Geschäftsleitungen oder Verwaltungsräten sprechen: Welches Bedauern hören Sie am häufigsten im Zusammenhang mit Investitionen in zentrale Systeme?
MP: Es ist weniger Bedauern als vielmehr schade, wenn enorme Summen in die Entwicklung einer zentralen Kernapplikation fliessen, die am Ende nicht die formulierten Anforderungen unterstützt oder wenn die Software selbst so stark angepasst wird, dass sie die bestehenden, nicht überarbeiteten Prozesse bedienen kann. Anstatt Effizienz und Qualität zu steigern, entstehen hohe Betriebs- und Weiterentwicklungskosten.
PN: Damit werden genau jene Ressourcen blockiert, die eigentlich in innovative Themen investiert werden sollten. Besonders sichtbar wird dies derzeit beim Einsatz von AI: So bindet etwa die Einführung und der Betrieb eines CRM- oder ERP-Systems sämtliche Kräfte und verschlingt das gesamte Budget, wodurch für die Entwicklung relevanter Anwendungsfelder neuer Technologien weder Zeit noch finanzielle Mittel übrig bleiben.
Welchen Rat würden Sie also Unternehmen geben, die einen Technologieberater suchen?
MP: Fragen Sie nach der Praxiserfahrung der Menschen, die Sie beraten werden. Fragen Sie, ob die Berater schon selbst ein Projekt technisch umgesetzt haben – welche Rolle sie gespielt haben und welche Verantwortung sie bereit sind zu übernehmen. Und vor allem: Klären Sie ab, ob Ihr potenzieller Partner herstellerunabhängig ist. Eine Beratung sollte immer im besten Interesse des Kunden handeln, und das geht nur mit völliger Freiheit in der Wahl der besten Technologie.
Text: Stephan Ziegler
Bild: Marlies Beeler-Thurnheer