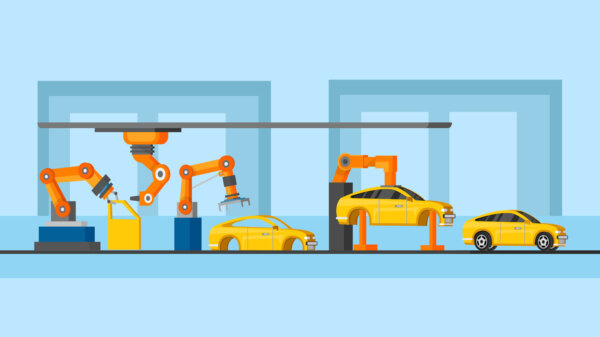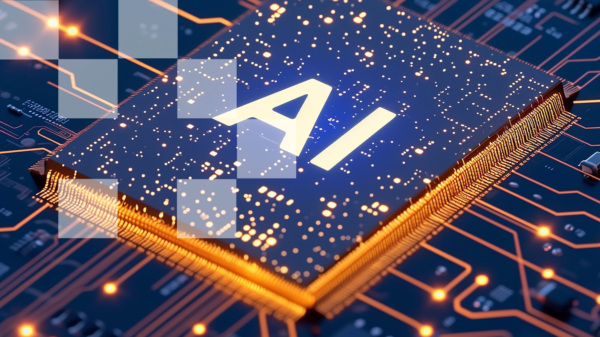«Ein Unternehmer übernimmt Verantwortung»

Urs Füglistaller, als einer der drei Direktoren des KMU-Instituts der HSG und als ehemaliger Verwaltungsrat in vielen Firmen haben Sie jahrzehntelang Unternehmer beobachtet. Was zeichnet einen Unternehmer aus?
Ein Unternehmer übernimmt Verantwortung, und zwar für die «drei W»: Zum einen die Wertschöpfung, das liegt auf der Hand. Ein Unternehmer muss schauen, dass der Laden läuft, dass er Liquidität erwirtschaftet und gute Werke – Dienstleistungen, Produkte, Aktivitäten – erschafft. Zum anderen muss er auch die Wertschätzung leben. Dafür muss man seinem Vis-à-vis auf Augenhöhe begegnen.
Wer ist dieses Vis-à-vis?
Man könnte auch von Gegenüber oder von Stakeholdern sprechen: Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden, Banken, Behörden ... Mir gefällt der Begriff Vis-à-vis jedoch viel besser. Und Wertschätzung kann man nur geben, wenn man sich auf sein Vis-à-vis freut; man muss sich der Begriffe, der verwendeten Sprache und auch der nonverbalen Kommunikation bewusst sein – «Lebenskorrektheit» nennt es Sloterdijk mit kritischem Blick. Das bedingt jedoch den dritten W-Begriff: die Werthaltung. Sie ist für mich der Ursprung, dass man überhaupt Wertschätzung geben kann.
Das klingt sehr philosophisch. Im KMU-Institut der HSG umschreiben Sie Wirtschaftstheorie stets auch sehr pragmatisch ...
Wenn sich ein Unternehmer auf seinen Kunden freut, sich auf den Montagmorgen freut, wenn er wieder mit seinen Leuten – auch operativ – zusammenarbeiten kann, dann hat das sehr viel mit Werthaltung zu tun. Werthaltung kann man auch mit der «via negativa» beschreiben – also mit dem, was man sicher nicht machen will.
«Der Dreiklang Wertschöpfung, Werthaltung, Wertschätzung umschreibt sehr gut, was einen Unternehmer ausmacht.»
Funktioniert das?
Wenn wir in Workshops mit KMU einmal nicht weiterkommen, drehen wir die Frage um und fragen: Was macht ihr sicher nicht? Dann sprudelt es. Und das hat mit Werthaltung zu tun. Ich erinnere mich an einen IT-Hersteller, der sagte, er liefere seine Produkte sicher nicht in die USA für den Einsatz in deren Panzern. Dadurch ist ihm ein Millionenauftrag entgangen. Die Amerikaner wollten ihn unbedingt, weil sie keine chinesischen Lieferanten mehr wollten. Die Werthaltung kann also über der Wertschöpfung stehen. Der Dreiklang Wertschöpfung, Werthaltung, Wertschätzung und das Jonglieren mit diesen drei Werten umschreiben sehr gut, was einen Unternehmer ausmacht. Die drei Ws sind in Bewegung. Es gibt keine Priorität in diesem Dreiklang.
Ein Unternehmer jongliert also?
Ja, und er oszilliert. Diese Fähigkeit ist etwas vom Wichtigsten: das Oszillieren zwischen strategischem Denken und operativem Handeln. Für mich war es in den vergangenen bald 40 Jahren faszinierend, Unternehmer zu erleben, die ganz nahe an und tief drin in ihrem Geschäft sind – und trotzdem ihre Firma von aussen betrachten können. Menschen, die genau wissen, wie ihre Drehmaschine funktioniert, was die Abfüllanlage kann – und gleichzeitig strategisch top sind: «Füsse auf dem Boden, Nase im Wind».
Unternehmer müssen sich also auch dehnen können.
Das ist ein gutes Bild. Denn Dehnen ist kontinuierliche Arbeit. Man kann nicht einmal im Monat Dehnübungen machen, man muss sich jeden Morgen dehnen. Unternehmer müssen nicht einen Spagat vollführen, aber sich dehnen im Sinne einer liebevollen Art, mit den drei W umzugehen: Operatives und Strategisches, Vergangenheit und Zukunft, Erfolge und Niederlagen zu verbinden. Das sind ganz viele Oszillationen, das ist für mich Unternehmertum.
Sprechen wir hier von universalen Werten, oder unterliegen diese dem Zeitgeist? Haben Sie vor 20 Jahren andere Dinge gepredigt, oder gibt es fundamentale Werte, die heute noch gleich sind?
Lustig ist ja, dass Sie das Wort «predigen» in den Mund nehmen. Ich bin eher der «Wahrnehmer». Das Vis-à-vis zu schätzen, habe ich schon vor 20 oder 30 Jahren für eminent wichtig gehalten. Was ich heute viel mehr gewichte, und das ist vielleicht eine Änderung: Ich bin immer stärker überzeugt, dass es Sinnhaftigkeit und Sinnlichkeit in der Führung auf allen Ebenen braucht. Vor einigen Jahrzehnten galt die Orientierung auf die Wertschöpfung noch mehr – Lean Management, Just-in-Time waren angesagte Theorien. Es galt, möglichst viel Geld zu verdienen, der Shareholder-Value war wichtig.
Das ist er immer noch.
Natürlich, aber ergänzt mit einer Werthaltung. Bei mir bekommt inzwischen auch der Begriff Ästhetik eine bedeutende Rolle.
Im Management-Vokabular ein eher seltener Begriff.
Klar, und wenn man einem Unternehmen, das gerade extrem unter Druck steht, weil es von den US-Zöllen stark betroffen ist, damit kommt, ist das einigermassen kontrovers. Wenn es um das nackte Überleben geht, zählt Ästhetik wenig. Ich bleibe aber dabei, dass Sinnhaftigkeit und Sinnlichkeit wichtig sind – auch im Geschäft mit den Amerikanern.
«Die jungen Leute haben andere Lebenskonzepte als die Generationen vor ihnen.»
Und die Ästhetik?
Die Straight-Forward-Haltung von einigen unserer Industrie-Patrons, die wir vielleicht als coole Typen bezeichnen, hat durchaus eine gewisse Ästhetik.
Wenn Sie einen solchen Wertekanon von Unternehmern skizzieren, sieht das Bild von jungen Unternehmern anders aus?
Junge Unternehmer haben grundsätzlich die gleichen Werte, aber diese stehen in einer anderen Hierarchie. Die Bedeutung von Cashflow, die Bedeutung von Ebitda wird relativiert durch Fragen wie: Kann ich 60 Prozent arbeiten? Gibt es eine Möglichkeit, dass wir uns ökonomisch und auch ökologisch verhalten? Und auch sozialverträglich? Das sind sehr ernste Themen, die früher kaum eine Rolle spielten. Jetzt aber erlebe ich bei meinen Studenten, dass sie sehr stark darauf ansprechen.
Das klingt nach Zeitgeist.
Sie fragen sich, ob sie es so wie frühere Generationen machen wollen: 100 Prozent Lohn erhalten, deutlich mehr als 100 Prozent dafür arbeiten. Die Antwort ist: Sie wollen es nicht. Die jungen Leute haben andere Lebenskonzepte als die Generationen vor ihnen, und trotzdem ist Wertschöpfung noch wichtig, dessen sind sie sich sehr wohl bewusst.
Auch interessant
Aber die Werte ändern sich?
Es gibt einen Wandel bei der Konkretisierung der Werthaltung. Heute kann eine Ärztin für sich beschliessen, dass es okay ist, 60 Prozent zu arbeiten – obwohl sie weiss, dass sie politisch wahnsinnig unter Druck kommt: Sie wurde für Hunderttausende von Franken ausgebildet, also soll sie gefälligst auch 100 Prozent arbeiten. Doch die jungen Leute organisieren sich lieber anders, sie entwickeln neue Modelle, Ärzte beispielsweise in Praxisgemeinschaften. Hinter all dem steht eine Werthaltung.
Die Wertschöpfung ist somit kein Selbstzweck?
Sinnhaftigkeit und Sinnlichkeit liegen nahe bei Werthaltung und Wertschöpfung. Die Wertschätzung folgt dann daraus. Das kann sich darin äussern, dass die Ärztin sich nicht nur um ihr eigenes Wohlbefinden kümmert, sondern sich auch mehr Zeit für einen Patienten nimmt, weil sie merkt, dass dessen Problem nicht bloss eine vordergründige medizinische Frage ist. Übertragen auf Unternehmer stellt sich die Frage: Ist mein Gegenüber jemand, der mein Anliegen ernst nimmt, oder möchte er nur Geld verdienen an mir? Unternehmer können mit ihrer Sprache, mit ihrer Körperhaltung signalisieren, dass sie mit ihrem Vis-à-vis eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen wollen.
Ticken die jungen Unternehmer so?
Ja.
Einzelne, oder ist das ein Trend, der generell für diese Generation gilt?
Das ist einer von mehreren Trends. Es gibt selbstverständlich auch heute Leute, die sich ausschliesslich an der Wertschöpfung orientieren. Die Jungen ticken nicht alle gleich.
Wie wirkt sich das in Familienunternehmen aus, wenn die junge Generation Werte anders gewichtet als ihre Vorgänger?
Da habe ich einige spannende Beobachtungen gemacht. Das Credo von Familienunternehmen ist traditionellerweise: Wir wollen auch nach 30 Jahren noch existieren. Heute gibt es aber Nachkommen in Unternehmerfamilien, die geradeheraus fragen: Wieso sollen wir die Firma weiterführen? Wir könnten sie ja auch verkaufen oder in ein Joint Venture einbringen und dann etwas anderes machen.
Das gibt Krach am Familientisch.
Oh ja, ein solcher Befreiungsschlag ist dramatisch. In einem «Das-haben-wir-schon-immer-so-gemacht-Milieu» kommt plötzlich ein Sprössling und sagt: «Papi, ich kann die Firma auch einfach verkaufen.» Der Vater antwortet in der Regel mit: «Das kommt gar nicht infrage!» Am schlimmsten ist es, wenn eine solche Situation zu einer Lethargie führt und die Tochter oder der Sohn sagt, okay, dann mache ich das eben noch ein bisschen – ohne Herzblut.
Dann fehlt gemäss Ihrer Terminologie die Komponente Sinnhaftigkeit.
Genau. Und wenn die Sinnhaftigkeit weg ist, nützt die ganze Sinnlichkeit auch nichts mehr. Deshalb stellen sich die Jungen genau solche Fragen. Momentan erleben wir eine Liberalisierung in dem Sinne, dass es mehr Freiheit gibt, was man mit einer geerbten Firma machen kann. Die Jungen sprechen neue Themen an, sie wagen neue Optionen. Deshalb wird die riesige Anzahl von Familienfirmen der Babyboomer nicht ausschliesslich in Familienhand bleiben.
Die – potenziellen – Unternehmer von morgen agieren rationaler und darum auch freier?
Hmmm, nochmals ja. Seit den Sechzigerjahren hatten wir in der Schweiz keine ernsthafte kriegerische Bedrohung, wir Eltern haben Geld verdient, sie wuchsen in einem warmen Nest auf. Sie haben das Gefühl von Freiheit, aber auf der anderen Seite ein Gedankengut, das ich sehr schätze, das zum nüchternen Abwägen aller Optionen führt. Sie denken alle Szenarien durch.
Das klingt nach einer komfortablen Situation.
Das ist auch gefährlich. In den letzten 40 Jahren ist viel Tafelsilber angesammelt worden, es wurden grosse Vermögenswerte aufgebaut. Manchen Betrieben bricht der Umsatz komplett weg, aber gleichzeitig haben sie noch viel Eigenkapital. Es ist extrem gefährlich, wenn die Umsatzentwicklung gegen null tendiert, aber die Haltung «Wir haben ja noch Geld» vorherrscht. Da wiegt man sich in falscher Sicherheit. Da braucht es einen Mahnfinger, da muss man aufzeigen, dass es nicht nur um Freiheit geht, sondern auch um Wertschöpfung.
«Die Jungen sprechen neue Themen an, sie wagen neue Optionen.»
Aber wer macht das? Sie?
Ich bin es nicht mehr; jedoch war ich es über lange Jahre. Ich bin mittlerweile aus allen meinen Engagements in Verwaltungsräten ausgestiegen.
Heute sind gute Verwaltungsräte nach komplementären Kompetenzen zusammengesetzt – brauchen junge Unternehmer idealerweise erfahrene Sparringpartner?
Diejenigen Firmen, die gerade – auch meinetwegen – neue Verwaltungsräte suchen, tun dies sehr gezielt. Sie möchten jemanden für das Thema Digitalisierung, jemanden mit Know-how in Marketing. Dann allenfalls noch juristisches Wissen. Themen wie Produktion oder Logistik sind in den Verwaltungsräten meistens schon abgebildet. Dass es Frauen braucht in Verwaltungsräten, ist eigentlich selbstverständlich. Was ich jetzt aber sehe: Die Verwaltungsräte werden massiv jünger.
Also keine Ratschläge von erfahrenen Wirtschaftsgrössen?
Nein, das Vis-à-vis in einer strategischen Diskussion ist nicht mehr zwingend ein reiferer früherer Manager, sondern vielleicht ein 32-jähriger IT-Nerd oder eine junge Frau, die viel Designkompetenz mitbringt. Da gibt es eine grundlegende Veränderung. Und das ist richtig.
Text: Philipp Landmark
Bild: Marlies Beeler-Thurnheer