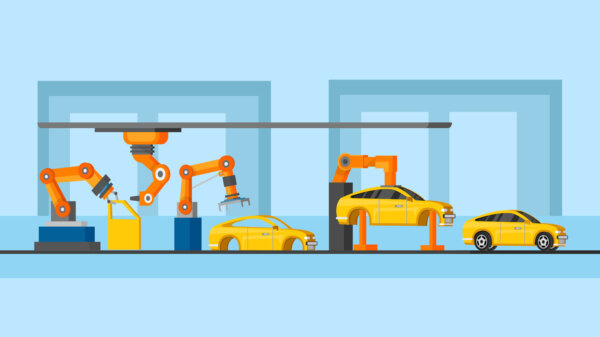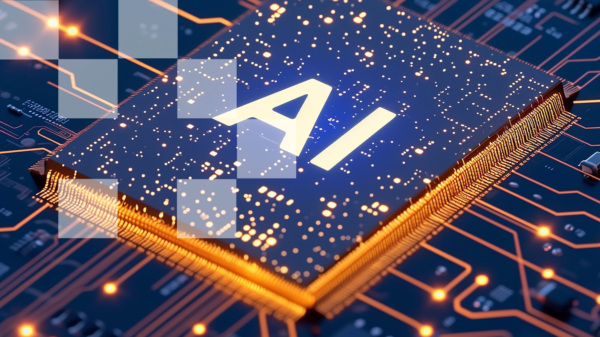Wirtschaftsfaktor mit Zukunft

Prägend für die heutige «Generation Erfahrung» sind tiefgreifende wirtschaftliche und gesellschaftliche Umbrüche. «Wer heute 50 oder 60 ist, hat mitten im Berufsleben Digitalisierung und Globalisierung bewältigt: vom ersten PC über das Internet bis zu Smartphone, Cloud und KI, von lokalen Strukturen zu internationalen Lieferketten und interkultureller Zusammenarbeit», sagt Stephan Böhm.
Dazu kamen neue Organisationsformen: Hierarchien wurden flacher, Projektarbeit und agile Methoden hielten Einzug. «Diese Generation hat gelernt, sich in hochdynamischen Umfeldern zu behaupten», sagt Sophie Schepp. «Sie ist die erste ältere Kohorte, die einen wesentlichen Teil des Berufslebens in einem digital vernetzten Umfeld verbracht hat.» Auch externe Schocks prägten den Weg: die Finanzkrise 2008, die COVID-19-Pandemie, geopolitische Spannungen. Parallel wuchs der Stellenwert von Bildung und lebenslangem Lernen; Gesundheitsbewusstsein, Prävention und persönliche Weiterentwicklung gehören für viele selbstverständlich dazu.
«Mit zunehmendem Alter verschiebt sich der Fokus von Breite zu Tiefe.»
Weniger Gegensätze als angenommen
Wer Werte und Haltungen vergleicht, findet weniger Gegensätze als oft angenommen. «Alle Generationen streben nach beruflichem Erfolg und nach Selbstverwirklichung», sagt Böhm. «Mit zunehmendem Alter verschiebt sich der Fokus allerdings von Breite zu Tiefe: weg von Quantität und Erkundung, hin zu Qualität, Sinn und passgenauer Nutzung der eigenen Stärken.» In der Psychologie steht dafür das Zusammenspiel von Fluid- und Kristalliner Intelligenz. Jüngere lösen Probleme oft schneller und lernen Neues leichter; Ältere greifen wirkungsvoll auf Erfahrung und Wissen zurück. «Entscheidend ist, Ziele flexibel zu justieren und die eigene Energie dort einzusetzen, wo sie den grössten Hebel hat», so Schepp.
Diese Selbststeuerung zeigt sich im Arbeitsalltag. Viele richten ihre Aufgaben so aus, dass Stärken besser zum Tragen kommen. «Man spricht von Job Crafting», erklärt Schepp. «Mitarbeiter gestalten ihre Tätigkeit aktiv, passen Aufgaben an, entwickeln Routinen und bauen Netzwerke – so entsteht langfristige Arbeitsfähigkeit.» Gleichzeitig erleben Ältere noch immer Formen der Altersdiskriminierung. Die offensichtlichen Fälle – von abgelehnten Bewerbungen bis zu verwehrten Beförderungen – sind die eine Seite. Mindestens so bedeutsam sind subtile Muster: geringere Einbindung, herabsetzende Bemerkungen, Unterforderung oder der Ausschluss aus informellen Netzwerken. «Solche weichen Formen haben harte Folgen», sagt Böhm. «Sie senken die Arbeitszufriedenheit, können die psychische und körperliche Gesundheit beeinträchtigen und sie gefährden die Motivation, Wissen weiterzugeben.»
Für Unternehmen ist das ein ökonomisches Thema: Teams mit Altersvielfalt profitieren vom dichten Erfahrungsschatz, kürzeren Einarbeitungszeiten und stabilen Prozessen. Die Mischung wirkt innovationsfördernd, weil verschiedene Denkstile zusammenkommen und Gruppendenken weniger Raum erhält. «Gleichzeitig ist Altersdiversität kein Selbstläufer», sagt Böhm. «Es braucht aktives Management, damit Kommunikationsbarrieren, Missverständnisse und Rollenunklarheiten die Leistung nicht bremsen.»
«Auch als Konsumenten sind Golden Ager ein Faktor.»
Inklusive Führung als wichtiger Hebel
Ein wirksamer Hebel ist inklusive Führung. «Wir definieren Inklusion anhand des ‹St.Gallen Inclusion Index› mit vier Dimensionen: Authentizität, Zugehörigkeit, Perspektivenvielfalt und Chancengleichheit», erklärt Stephan Böhm. «Führungskräfte sollten diese Dimensionen sichtbar leben – unterschiedliche Sichtweisen einbeziehen, faire Chancen schaffen und auch unbequeme Meinungen zulassen.» Dazu gehören altersinklusive HR-Praktiken: transparente Weiterbildung, Auswahl- und Beförderungsprozesse ohne Altersbias, flexible Arbeitsmodelle und klar geregelter Wissensaustausch.
Auch als Konsumenten sind Golden Ager ein Faktor. In der Schweiz ist heute rund ein Fünftel der Bevölkerung 65 Jahre oder älter, mit steigender Tendenz. «Diese Gruppe verfügt über erhebliche Kaufkraft, setzt auf Qualität und ist neuen Technologien gegenüber oft aufgeschlossen», sagt Sophie Schepp. Viele Unternehmen verfehlen sie jedoch mit einer rein altersbezogenen Ansprache. «Besser ist eine psychografische Segmentierung und ein universelles Design. Produkte, die für viele Zielgruppen intuitiv sind – gut lesbar, einfach bedienbar, wenig komplex –, funktionieren für Ältere genauso wie für Jüngere.» Wer Inklusion als Designprinzip ernst nimmt, erweitert den Markt und vermeidet Stigmatisierung. «Entscheidend sind Vertrauen, Servicequalität und persönliche Empfehlungen – diese Faktoren wiegen bei dieser Zielgruppe oft mehr als laute Werbung.»
Lebensstil und Lebenslust im dritten Lebensabschnitt sind vielfältig. Mit dem Alter divergieren physische und kognitive Verläufe stärker; Schlaf, Bewegung, Ernährung und mentale Fitness beeinflussen das Tempo des Alterns. Viele Menschen justieren Ziele, reduzieren Komplexität und investieren fokussiert in Tätigkeiten mit hoher persönlicher Bedeutung. «Das ist kein Rückzug, sondern eine kluge Schwerpunktsetzung», sagt Böhm. «Wer Ziele an Ressourcen anpasst, bleibt leistungsfähig – beruflich, sozial und privat.» Unternehmen können das unterstützen: durch spätere Karriereschritte, projektbasierte Einsätze, Weiterbildungen on demand, Mentoring und Formate für den gezielten Wissenstransfer.
Auch interessant
Ökonomisch doppelt relevant
Digitalisierung taugt als Brücke statt als Barriere, wenn Rahmenbedingungen stimmen. «Ältere sind lernfähig, weil kognitive Plastizität bis ins hohe Alter erhalten bleibt», sagt Schepp. «Es braucht passgenaue Trainings, einfache Nutzeroberflächen und einen systematischen Austausch zwischen Generationen. Reverse Mentoring, bei dem Jüngere digitale Routinen teilen und Ältere mit Erfahrungswissen zurückgeben, ist besonders wirksam.» Wo Technologien Abläufe vereinfachen – Terminbuchung, Telemedizin, Banking, Behördenkontakte – steigt die Teilhabe spürbar. Voraussetzung sind Datensouveränität, Datenschutz und Supportangebote, die nicht bevormunden. Ökonomisch ist die Generation Erfahrung doppelt relevant: als Fachkräfte und als Nachfrager. In vielen Branchen treffen Engpässe auf wachsende Nachfrage. «Ältere Mitarbeiter schliessen Lücken, sichern Qualität und Stabilität und helfen, Prozesse resilient zu machen», sagt Böhm. «Gelingt es, sie länger im Erwerbsleben zu halten, profitieren Unternehmen und Volkswirtschaft gleichermassen.»
Für die Ostschweiz heisst das, Arbeitsangebote für erfahrene Spezialisten attraktiver zu gestalten und regionale Netzwerke zu stärken. Kooperationen zwischen Unternehmen, Bildungsträgern und öffentlichen Institutionen können Weiterbildung, Vermittlung und projektbasierte Einsätze bündeln. «Wichtig ist eine Haltung, die ältere Menschen aktiv einbezieht – sie wissen am besten, was sie können und brauchen.»
«Wichtig ist eine Haltung, die ältere Menschen aktiv einbezieht.»
Erfahrung soll im System bleiben
Auf der Konsumseite gilt Ähnliches: Relevante Angebote entstehen, wenn Unternehmen die Vielfalt älterer Kunden ernst nehmen, statt sie als homogene Zielgruppe zu behandeln. Gesundheit, Mobilität, Wohnen, Freizeit, Sicherheit, Finanzen, Kultur und Reisen – in fast allen Feldern liegt Potenzial. «Wer Produkte und Services inklusiv denkt, gewinnt auch jüngere Kunden. Einfachheit, Verlässlichkeit und guter Service sind altersübergreifende Qualitätsmerkmale», sagt Schepp.
Böhms und Schepps Blick nach vorn ist realistisch und zuversichtlich: Der demografische Wandel setzt sich fort; Erwerbsbiografien werden länger und vielfältiger. «Entscheidend ist, Gestaltungsspielräume zu öffnen, statt starre Altersgrenzen zu verteidigen», sagt Böhm. Flexible Übergänge in den Ruhestand, Teilzeit in späten Karrierephasen, projektbasierte Mandate nach der Pension und eine Kultur des gegenseitigen Lernens erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Erfahrung im System bleibt. «Mit der Generation Erfahrung statt über sie zu sprechen – das ist der Schlüssel, um Potenziale zu nutzen und Stereotype abzubauen», sagt Schepp.
Was heisst das für die Praxis? Erstens lohne es sich, Altersbilder zu überprüfen. Wenn Unternehmen Kompetenzprofile statt Geburtsjahre in den Vordergrund stellen, gewinnen sie an Präzision. Zweitens braucht es Strukturen, die Wissen systematisch sichern: Tandems, Dokuwissen, Communities of Practice, Peer-Learning. Drittens sollten Rekrutierung und Entwicklung an Leistungsindikatoren ausgerichtet sein, nicht am Alter. «Fairness in Prozessen, Transparenz bei Chancen und eine klare Erwartung, dass alle lernen – das sind die robusten Pfeiler einer altersinklusiven Kultur», sagt Böhm. «Wer diese Pfeiler baut, wird beim Fachkräftemangel im Vorteil sein.»
Mehr als eine demografische Grösse
Viertens ist Kundennähe ein Differenzierer. Serviceketten, die am ersten Kontaktpunkt verständlich und barrierearm sind, reduzieren Abbrüche und erhöhen die Loyalität. Persönliche Beratung, verlässliche Erreichbarkeit und verständliche Sprache zahlen direkt auf Vertrauen ein. «Ältere Kunden entscheiden nicht langsamer, sondern sorgfältiger – sie vergleichen Erfahrungen und wägen Nutzen und Aufwand ab», sagt Schepp. «Wer das respektiert, gewinnt langfristig treue Kunden.» Schliesslich lohnt der Blick auf Kennzahlen. Wenn Unternehmen Einstellungen, Verweildauer, Weiterbildungsquoten, Gesundheitsindikatoren und Produktivitätsmasse nach Altersgruppen beobachten, lassen sich blinde Flecken in der Organisation erkennen. «Daten helfen, Mythen zu entkräften», sagt Böhm. «Oft zeigt sich, dass altersgemischte Teams stabiler liefern – vorausgesetzt, die Führung schafft die richtigen Bedingungen.» Solche Analysen erfordern Sensibilität und Datenschutz, sind aber eine Grundlage für wirksame Entscheidungen. Die Generation Erfahrung ist damit weit mehr als eine demografische Grösse. Sie steht für Kompetenz, Loyalität, Qualitätsbewusstsein und ein hohes Verantwortungsgefühl – Eigenschaften, die in volatilen Zeiten besonders wertvoll sind. «Wenn Arbeitsumfelder und Angebote altersinklusiv gestaltet werden, bleibt Erfahrung länger im Spiel und schafft messbaren Nutzen», sagt Schepp. «Das ist eine Chance für Unternehmen, Regionen und die Gesellschaft insgesamt.»
Inklusion stiftet Mehrwert
Ein realistischer Blick auf Risiken gehört dazu. «Erhöhte wahrgenommene Altersdiskriminierung korreliert mit höherem Depressionsrisiko, schlechterer selbst eingeschätzter Gesundheit und geringerer Arbeitszufriedenheit», sagt Stephan Böhm. «Es geht also nicht nur um Fairness, sondern um Leistungsfähigkeit, Fehlzeiten und Bindung – und damit um harte wirtschaftliche Kennzahlen.» Das Gegenmittel seien eine klare Haltung, Sensibilisierung und konsequente Umsetzung in allen Personalprozessen.
Auch im Design von Produkten zeigt sich, wie Inklusion Mehrwert stiftet. «Gute Lesbarkeit, klare Navigation, verständliche Sprache, ausreichende Kontraste und einfache Fehlerkorrekturen helfen allen Nutzern – nicht nur Älteren», sagt Sophie Schepp. «Wer das Nutzererlebnis auf Reibungsarmut trimmt, steigert Akzeptanz und Loyalität über alle Altersgruppen hinweg.» In Services wirkt sich das auf die gesamte Kette aus: vom ersten Kontakt über digitale Formulare bis zur persönlichen Beratung. Die langfristige Perspektive ist demografisch geprägt. Seit dem späten 19. Jahrhundert hat sich die Lebenserwartung dank Medizin, Hygiene, Ernährung, Wohnsituation und besseren Arbeitsbedingungen deutlich erhöht. «Wir werden länger leben und länger arbeiten», sagt Böhm. «Das eröffnet Chancen – vorausgesetzt, wir gestalten Arbeit altersgerecht und sichern Lernmöglichkeiten in jeder Phase der Erwerbsbiografie.» Dazu gehören Weiterbildungen, die sich an realen Aufgaben orientieren, niedrigschwellige digitale Lernpfade und Angebote, die Tempo und Tiefe individuell dosieren. Für die Ostschweiz lässt sich daraus ein Programm ableiten: Regionale Pools erfahrener Fachkräfte für projektbasierte Einsätze, Wissensallianzen zwischen Unternehmen und Hochschulen, und Plattformen, auf denen Pensionäre mit Mandaten punktuell zurückkehren können. «Solche Modelle verbinden Qualitätssicherung mit Nachwuchsförderung und machen die Region widerstandsfähiger», sagt Schepp. «Wenn Politik, Unternehmen und Bildungspartner das gemeinsam anpacken, wird die Generation Erfahrung zum Standortvorteil.»
Text: Stephan Ziegler
Bild: Marlies Beeler-Thurnheer, zVg