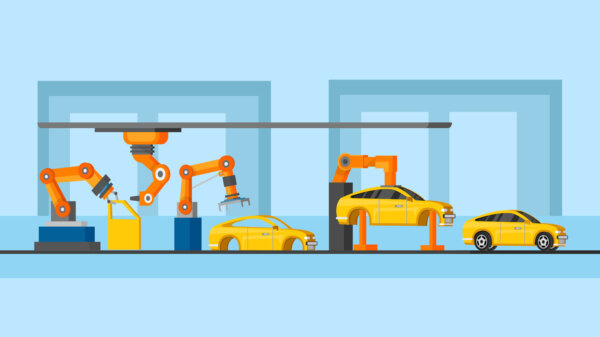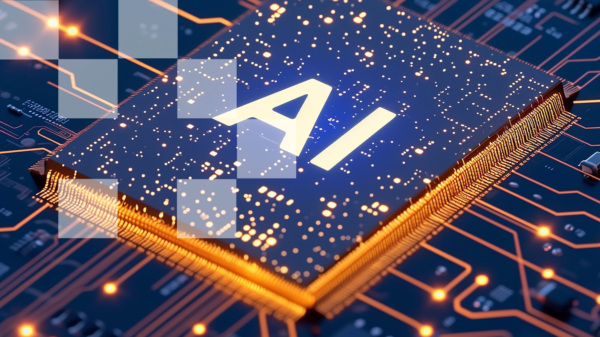So sehen die Banken den Immobilienmarkt

Ostschweiz wird für Investoren attraktiv
«Die Wohnungsknappheit trifft die Schweiz ungleich», sagt Fabian Waltert, Ökonom im UBS Chief Investment Office. Stark betroffen seien Zentren sowie viele Gebiete Graubündens und der Zentralschweiz; in St.Gallen, Thurgau und Appenzell ist die Lage noch entspannter. Die Leerstände fallen jedoch auch hier: rund 1,4 Prozent in Thurgau und St.Gallen – wie letztmals vor gut 15 Jahren. Preise und Mieten steigen, vor allem im Sarganserland und im Linthgebiet.
«Verdichtetes Bauen ist zeitaufwendig und kostspielig.»
Die Ursachen liegen auf Nachfrage- und Angebotsseite: anhaltende Zuwanderung, mehr Einpersonenhaushalte und zu geringe Bautätigkeit. In der Ostschweiz werde etwas mehr gebaut; im Thurgau viel, in St.Gallen deuteten Baugesuche auf mehr Aktivität hin, so Waltert. Strukturell bremse die Verdichtung: «Sie ist aufwendiger, stösst auf Widerstand; lange Bewilligungsverfahren, komplexe Vorschriften und Einsprachen verzögern.» Konjunkturell dämpften höhere Zinsen und Baukosten; mit tieferen Zinsen und stabileren Kosten komme wohl Rückenwind zurück, wirke aber verzögert und reiche «noch nicht für spürbare Entspannung». An Investoren mangelt es nicht, und Fabian Waltert sieht keine Blasengefahr. Wie Regulierung bremst, illustriert er so: In Basel führte ein Mietpreisdeckel zum Einbruch der Bautätigkeit; ähnliche Vorstösse in Zürich und Bern lassen Investoren Zentren meiden. «Thurgau und St.Gallen sind weniger reguliert und wachsen überdurchschnittlich – das macht die Ostschweiz attraktiv und stützt die Wohnraumversorgung.»
Leerstände in der Ostschweiz sinken
In Appenzell Ausserrhoden, St.Gallen und Thurgau seien Leerstände und Angebotsquoten insgesamt höher als im Schweizer Mittel – einerseits wegen der ländlicheren Struktur, anderseits wegen eines flexibel reagierenden Angebots, sagt Francis Schwartz, Ökonom im Raiffeisen Economic Research. «Gleichwohl sinken die Leerstände, da häufig die Nachfrage schneller wächst als das Angebot.» Am stärksten spannt sich der Markt im Kanton St.Gallen an; im Thurgau zeigen sich dank hoher Bautätigkeit erst wenige Knappheitssymptome. Treiber sind Bevölkerungsdynamik, Demografie und zunehmende Individualisierung, während das enge raumplanerische Korsett das Bauen erschwert.
«Betongold ist als Anlageklasse weiter gefragt.»
Auch die Vorschriften würden komplexer; Private könnten anspruchsvollere Projekte kaum mehr allein stemmen – «nur noch Profis behalten den Durchblick». Ein Finanzierungsproblem sieht Schwartz indes nicht: Trotz Basel III, strengeren Liquiditätsanforderungen und dem Aus der Credit Suisse gebe es keine «Kreditklemme». Eher sei eine Verschiebung hin zu institutionellen Bauträgern zu erwarten; für stark gehebelte Investoren hätten sich die Konditionen verschlechtert.
Die Renditen sind wegen hoher Immobilien- und Baulandpreise zwar tief, doch bei wieder sehr tiefen Zinsen bleiben Immobilienanlagen attraktiv. «Betongold ist als Anlageklasse weiter gefragt.» Eine Blase sieht Schwartz nicht: Die hohen Preise seien durch hohe Nachfrage und knappes Angebot erklärbar; ein spekulatives Element fehle.
Unzureichende Neubautätigkeit limitiert Angebot
Wohneigentum bleibe beliebt, sagt René Walser, Leiter Privat- und Geschäftskunden bei der St.Galler Kantonalbank: Im 1. Quartal 2025 stiegen die Suchabonnemente für Eigentumswohnungen im Kanton St.Gallen um fast 20 Prozent, ähnlich bei Einfamilienhäusern, während das Angebot schrumpfte. Die Angebotsziffern lagen bei 3,0 Prozent für Eigentumswohnungen und 1,4 Prozent für Einfamilienhäuser; beide Werte liegen unter Schweizer Durchschnitt und Zehnjahresmittel. In Appenzell Ausserrhoden nahmen die Suchabos um knapp 30 Prozent zu; in Teufen und Herisau etwa übersteigt die Nachfrage das Angebot deutlich. Ursachen sind hohe Nachfrage und wenig Neubau.
«Mit einer raschen Ausweitung des Angebots ist nicht zu rechnen.»
Für Einfamilienhäuser sei keine Entspannung absehbar, bei Eigentumswohnungen zeige sich eine moderate Belebung, so Walser: Innert zwölf Monaten wurden rund zehn Prozent mehr Neubaugesuche eingereicht. Auch er beobachtet, dass Einsprachen und Rekurse die Bautätigkeit bremsen. «60 Prozent der befragten Fachpersonen nennen Einsprachen und Rekurse als grösste Hürde, 80 Prozent der Bauträger melden Verzögerungen und 71 Prozent Preissteigerungen.»
Die höheren Zinsen 2022/23 dämpften die Nachfrage institutioneller Anleger; mit tieferen Zinsen dürfte sie zurückkehren, jedoch verzögert, schätzt René Walser. «Basel III erhöht allerdings die Eigenmittelanforderungen, vor allem bei Renditeobjekten und Promotionsbauten. Zusammen mit steigenden Baukosten bremst dies die Bautätigkeit.»
Auch interessant
Zuwanderung ist ein Nachfragetreiber
Anita Schweizer, Leiterin Kommunikation und Generalsekretariat der Thurgauer Kantonalbank, bringt es so auf den Punkt: «Der Wohnungsbau in der Schweiz hält mit der Nachfrage nicht Schritt.» Zwar entstehen wieder etwas mehr Wohneinheiten, doch das Angebot bleibe zu klein. Den Nachfrageüberhang treiben vor allem eine anhaltende Zuwanderung und ein höherer Wohnflächenbedarf durch mehr Ein- und Zweipersonenhaushalte. Die Leerstandsquote sank stetig und liegt aktuell schweizweit bei 1,1 Prozent; St.Gallen und Thurgau liegen bei 1,4 Prozent, Appenzell Ausserrhoden bei 1,3 Prozent und Appenzell Innerrhoden bei 1,0 Prozent.
«Der Thurgauer Immobilienmarkt funktioniert nach wie vor.»
«Im Thurgau wurde in den letzten 25 Jahren überdurchschnittlich viel gebaut; nach einem Dämpfer hat die Bautätigkeit wieder angezogen. Da jedoch mehr neue Haushalte als Wohnungen entstehen, bleibt der Druck hoch», so Schweizer. In St.Gallen stagniert der Wohnungsbau und liegt leicht unter dem Schweizer Mittel; auch dort wächst die Zahl der Haushalte schneller als das Angebot. Zudem dämpfen laut einer Studie von ARE und BWO mehr Einsprachen und Rekurse die Bautätigkeit – auch wegen Vorgaben zum verdichteten Bauen.
«Der Thurgauer Immobilienmarkt funktioniert; generelle Überhitzungserscheinungen sehen wir nicht», sagt Anita Schweizer. Als führende Hypothekarbank finanziere die TKB verantwortungsvoll und gehe keine überhöhten Risiken ein. Die Refinanzierung des Ausleihungswachstums mit Passivgeldern sei indes anspruchsvoller geworden.
Hohe Nachfrage nicht nur an Top-Lagen
Bevölkerungswachstum und der Wunsch nach mehr Wohnfläche treiben den Bedarf an Wohnraum, beobachtet Jürg Süess, Leiter Finanzieren Marktgebiet St.Gallen bei Acrevis: «Es wird daher mehr gebaut.» Eine pauschale Aussage über Wohnraumknappheit sei allerdings nicht möglich: «Die Situation ist nicht nur kantonal, sondern auch regional sehr unterschiedlich.» So lasse sich das Obertoggenburg nicht mit dem Zürichsee oder der Stadt St.Gallen vergleichen.
Zunehmende regulatorische Hürden und eine wachsende Zahl an Einsprachen bremsen den Wohnbau. Kapazitäten seien bei Baufirmen grundsätzlich vorhanden, so Süess, doch der Fachkräftemangel mindere die Effizienz – mit spürbaren Preisaufschlägen. Hinzu kommen höhere Material- und Arbeitskosten. Zu den Kostentreibern zählt Süess auch das Bauland: Es werde knapper, besonders an beliebten Wohnlagen. Das treibe die Bodenpreise und verteuere inzwischen auch Projekte an zweitklassigen Lagen; an Top-Lagen mit hoher Nachfrage steigen die Preise erst recht.
«Bauland wird immer knapper.»
Weil Mietliegenschaften nur geringe Renditen abwerfen, registriert Jürg Süess mehr Neubauten, die im Stockwerkeigentum verkauft werden. Die Gefahr einer Immobilienblase lasse sich nicht pauschal beurteilen, da die regionalen Unterschiede gross seien. Die Finanzierung sei indes kein Hemmnis: «Acrevis prüft attraktive Bauprojekte in ihrem Marktgebiet weiterhin offen und sorgfältig – unter Berücksichtigung der individuellen Kundensituation und der marktspezifischen Eigenheiten.»
Text: Philipp Landmark
Bild: zVg