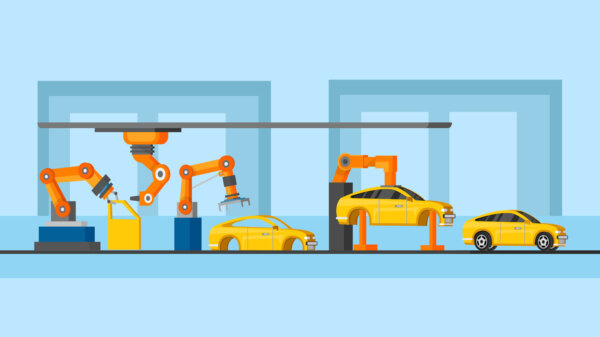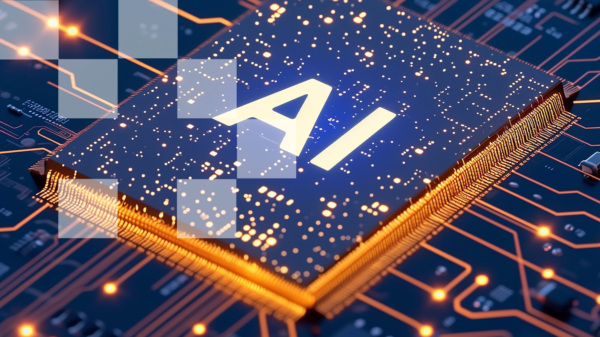«Wir müssen das verfügbare Land flexibler nutzen»

Peter Mettler, die Nachfrage nach Wohnraum ist riesig – das muss für Sie als Immobilien-Entwickler eigentlich eine traumhafte Situation sein.
Das wäre traumhaft, wenn man die passenden Grundstücke hätte, um Wohnbauten zu realisieren.
Wird deshalb weniger gebaut?
Das Hauptproblem ist nicht, dass wir zu wenig Land haben, sondern die geplante Verdichtung nicht zeitgerecht umsetzen können. Damit müssen wir uns abfinden, denn wir haben in einer Abstimmung beschlossen, dass es keine neuen Einzonungen mehr gibt und die bestehenden Zonen verdichtet werden sollen.
Das war die Revision des Raumplanungsgesetzes 2023.
Diese Anpassung wäre nicht weiter schlimm, wir verfügen über noch genug eingezontes Land. Nur müsste man das auch so nutzen können, wie es der Markt verlangt. Unser Raumplanungsgesetz ist ein starres Gebilde, das wenig zulässt. Wir haben zwar Instrumente wie Sondernutzungspläne, doch diese einzusetzen, dauert viel zu lange. Als Folge des revidierten Raumplanungsgesetzes müssen alle Gemeinden ihre BZO, die Bau- und Zonenordnung, überarbeiten.
Bis 2027 sollten diese Pläne rechtskräftig sein. Viele Gemeinden im Kanton St.Gallen haben sich beeilt, um dies umzusetzen, jedoch längst nicht alle.
«Die Amtsstellen können sich auf unsere Kosten unendlich viel Zeit nehmen.»
Die Stadt St.Gallen etwa.
Die Stadt St.Gallen wird 2027 nicht so weit sein, obwohl die zuständigen Stellen gute Arbeit leisten. Es wird auch darauf ankommen, wie viele Einsprachen es geben wird, wenn die BZO aufgelegt wird. Es dürfte sehr schwierig werden, dass die BZO für die ganze Stadt in einem Anlauf Rechtskraft erlangt. Es wäre deshalb sinnvoll, dass die städtische BZO-Revision auch quartierweise Gültigkeit erlangen könnte. Es wäre nicht konstruktiv, in Bruggen einen Bau nicht bewilligen zu können, weil in St.Fiden noch eine Einsprache hängig ist.
Die Stadt St.Gallen ist prädestiniert für Verdichtungen. Hilft da die künftige BZO?
Die Stadt St.Gallen hat sogenannte Schwerpunktzonen ausgeschieden, das ist ein erster Schritt. In diesen Bereichen kann man einfacher Sondernutzungspläne machen. Damit kann man die Ausnutzung der Zone erhöhen oder die engen Nutzungsbestimmungen als Gewerbezone oder Wohnzone aufweichen.
Funktioniert das?
Das funktioniert grundsätzlich gut, problematisch ist jedoch: Von dem Zeitpunkt an, ab dem ein Investor mit der Planung für eine Verdichtung einer Immobilie oder eines ganzen Areals mit einem Sondernutzungsplan beginnt, bis die Baubewilligung vorliegt, vergehen etwa viereinhalb Jahre.
Sofern es keine Einsprachen gibt.
Ja, selbstverständlich kommt es darauf an, wie viele Einsprachen es gibt. Das ist ein Problem für sich. Wenn ein potenzieller Bauherr investiert und mindestens viereinhalb Jahre warten muss, bis er eine Sicherheit hat, dass er das Projekt realisieren kann, dann ist das für einen Investor kaum noch interessant. Oft werden mehrere Millionen für das Areal ausgegeben, und in den viereinhalb Jahren Planungszeit fallen weitere zwei, drei Millionen an. Darum setzen viele Investoren lieber auf Bestandesliegenschaften oder gleich auf den Aktienmarkt.
Wieso dauert die Planung so lange?
Als Grundlage für einen Sondernutzungsplan muss ein Bauherr meistens einen Wettbewerb durchführen. Der Sondernutzungsplan wird danach aufgelegt und es gibt ein Mitwirkungsverfahren. Erst wenn dieses abgeschlossen ist, kann man ein Baugesuch einreichen. Zudem ist es in jeder dieser Phasen möglich, dass jemand Einsprache erhebt.
Was mit grosser Wahrscheinlichkeit auch passiert.
Die Problematik bei Einsprachen liegt oft nicht in der Einsprache selbst, sondern in den damit verbundenen langen Fristen bis zur Erledigung. Wer eine Einsprache erheben will, findet sehr viel Spielraum und genug Gründe, dies zu tun.
Wie lange dauert es denn, bis Einsprachen vom Tisch sind?
Wir warten bei einem grossen Projekt im Kanton Zürich, wo es um mehr als 500 Wohnungen geht und allein das Land mehr als hundert Millionen Franken gekostet hat, seit eineinhalb Jahren auf den Spruch des Verwaltungsgerichts. Kommt der Entscheid noch dieses Jahr, dann hätte allein diese zweite Instanz zwei Jahre benötigt. Zieht der Einsprecher weiter vor Bundesgericht, geht das noch einmal ein bis zwei Jahre. Insgesamt würde dann aufgrund von Einsprachen das Projekt um sechs Jahre verzögert. Die Amtsstellen können sich auf unsere Kosten unendlich viel Zeit nehmen.
Können die Amtsstellen wirklich so viel Zeit nehmen, wie sie wollen?
Im Kanton St.Gallen beispielsweise kennen die Gerichte keine Fristen. In Wil hatten wir ein Projekt, bei dem wir zehn Jahre auf eine rechtskräftige Baubewilligung warten mussten!
Eine solche Verzögerung macht ein Projekt entsprechend teurer.
Wir hatten das Glück, dass die Immobilienpreise während dieser Zeit kontinuierlich gestiegen sind und wir deshalb keinen Verlust erlitten haben. Ansonsten hätten wir eine grosse Abschreibung verbuchen müssen.
Auch interessant
Das Lieblingswort der Politik ist gerade «Fixpreis» – das dürfte bei Immobilien kaum funktionieren. Wie kann man den Preis von mehreren 100 Wohnungen festlegen?
Es gibt dafür komplexe Verträge, die Preise haben eine gewisse Dynamik. Jedoch ist klar, dass langen Verfahren zu höheren Kosten führen, welche schliesslich die Mieterschaft zahlt. Hingegen kann in Zukunft der Anstieg des Immobilienwertes nicht mehr so gross sein wie in den letzten zehn Jahren.
Woran machen Sie diese Prognose fest?
An der einfachen Feststellung, dass die Preise irgendwann einen Höhepunkt erreichen. In einer Volkswirtschaft muss man erkennen, wieviel eine durchschnittliche Person für Miete oder Kauf einer Immobilie ausgeben kann.
Obwohl eine grosse Nachfrage besteht?
Die Nachfrage ist grösser als das Angebot. Für Investoren sind jedoch die Unsicherheiten, bis sie etwas anbieten können, sehr gross. Bei einem überschaubaren Projekt, einem Gebäude mit zwölf Wohnungen in einer entsprechenden Zone, ist das weniger komplex, selbst wenn man da wahrscheinlich schon Einsprachen hat – meistens von Personen, die für sich noch etwas rausholen möchten. Bei einem grösseren Projekt muss man eine Verkehrsplanung machen, eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchführen, die Nachhaltigkeit zertifizieren und so weiter. Das ist ein dynamischer Prozess, und die Behörden sind dabei zum Teil auch sehr gefordert.
«Manchmal habe ich das Gefühl, dass St.Gallen keine Visionen mehr hat und der Mut zu Wachstum und Zukunft fehlt.»
Überfordert?
Bei unserem Projekt «Perronimo» in Wil waren die kantonalen Behörden eindeutig überfordert. Zudem hatte die Stadt Wil eine Bauabteilung, die sehr kompliziert agierte.
Immerhin steht das Projekt mit 75 Wohnungen, Ladenlokalen und Gewerbeflächen jetzt vor der Vollendung und kann auf den Markt gebracht werden.
Bis dahin war es ein beschwerlicher Weg. Wir haben gleich beim Bahnhof sieben Grundstücke von den SBB und anderen Grundeigentümern gekauft und zusammengeführt. Durch uns wurden erste Abklärungen gemacht, wir liessen einen Gestaltungswettbewerb durchführen. Auf dem Areal stand unter anderem das markante ältere Haus «Steinbock». Dies erforderte die Abklärung mit der Denkmalpflege des Kantons St.Gallen, ob das Haus stehen bleiben muss oder nicht. Die Denkmalpflege gab uns schriftlich den Bescheid, dass dieses Gebäude abgebrochen werden darf. Entsprechend gaben wir das so ins Wettbewerbsprogramm. Eine Jury, bestehend aus Behördenvertretern des Kantons und der Stadt Wil sowie fachkundigen Architekten, kürte ein Siegerprojekt. Aus diesem Siegerprojekt leiteten wir ein Richtprojekt für den Sondernutzungsplan ab. Als wir den Sondernutzungsplan gemäss Mitwirkungsverfahren auflegten, gab es verschiedene Einsprachen – insbesondere gegen den Abbruch des alten Gebäudes «Steinbock».
Das dürfte Sie nicht weiter beunruhigt haben.
Wir fühlten uns einigermassen sicher, weil wir genau diese Frage vorgängig abgeklärt hatten. Das wurde nicht nur vom Amt abgewogenen, es gab dazu auch Studien von unabhängigen Denkmalpflegern. Doch die Antwort vom Amt für Denkmalpflege auf die Einsprachen war: Das Haus «Steinbock» müsse stehen bleiben. Diese Kehrtwende war für uns nicht nachvollziehbar. In eineinhalb Jahren hat das Amt für Denkmalpflege seine Meinung um 180 Grad geändert. Schliesslich durften wir das Haus doch abreissen. Wir konnten es durch einen angepassten Neubau ersetzen.
Wie lange dauerte die Realisierung dieser Überbauung?
Wir haben zehn Jahre lang gearbeitet, bis wir die rechtskräftige Baubewilligung hatten. Die Bauzeit dauerte dann weitere zweieinhalb Jahre. Bis zum Baubeginn wurde alles mit Eigenkapital vorfinanziert, der Landkauf und sämtliche Honorare. Hierfür gab es keine Hypothek der Bank.
Wer heute ein etwas grösseres Projekt realisieren möchte, muss also finanziell ziemlich potent sein.
Heute braucht man grosse finanzielle Mittel, um etwas realisieren zu können. Das Kapital ist dann in diesem Projekt gebunden – bis dieses nach vielen Jahren abgeschlossen ist, kann man mit diesem Geld nichts anderes machen.
Wie könnte man denn die Bautätigkeit beschleunigen?
Stossend sind für uns zwei Sachen: Erstens, dass man heute für jede Kleinigkeit dreimal Einsprache erheben kann. Ohne Kostenfolge für die Einsprecher. Ich würde folgende Lösung sehen, dass eine erste Einsprache kostenlos ist, danach aber ohne Kostenvorschuss keine Einsprachen mehr möglich sind. Zweitens müssten sämtliche Schritte im Bauprozess, insbesondere Gerichtsprozesse, eine klare Termingrenze haben. Wenn sich das Baurekursgericht als erste Instanz mit einem Bauvorhaben befasst, sollte das maximal drei Monate dauern. Das Verwaltungsgericht sollte danach einen Fall in sechs Monate erledigen, ebenso das Bundesgericht.
Gerichte klagen unisono über zu viele Fälle und zu wenig Ressourcen.
Zum Teil sind sie auch einfach schlecht organisiert. Betrachten wir die Ostschweiz, dann fällt auf, dass im Thurgau mehr gebaut wird. Da ist vor allem die grössere Nachfrage der Treiber, weite Teile des Kantons gehören zum Einzugsgebiet von Zürich.
Wollen die Thurgauer das?
Ich denke schon. Natürlich gibt es überall auch solche, die nicht wachsen wollen.
Die Stadt St.Gallen wächst nicht mehr.
Unsere Stadtregierung ist rot-grün, die haben das Gefühl, mit ein paar Bäumen ist alles getan. Was eine Stadt tatsächlich lebenswert macht, scheint nicht zu zählen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass St.Gallen keine Visionen mehr hat und der Mut zu Wachstum und Zukunft fehlt.
Mit Ihrem Unternehmen sind Sie in der ganzen Deutschschweiz tätig. Wo läuft es am besten?
Die Mettler Entwickler AG hat mehr Projekte in Zürich als in der Ostschweiz. In Zürich sind diese auch alle grösser. In der Ostschweiz bearbeiten wir auch kleinere Projekte.
Auch interessant
Woher kommt dieser unterschiedliche Ansatz?
Ich bin ein St.Galler und baue gerne in St.Gallen, viele Ecken hier sind mir bekannt. Zudem kann ich einschätzen, wie viel man an diesen Standorten als marktgerechte Miete bezahlen könnte. Deshalb würden wir hier auch ein Zwölffamilienhaus realisieren, jedoch in Zürich nicht. Dort bevorzugen wir grössere Projekte, da dies im Hinblick auf unsere Unternehmensstruktur sinnvoller ist. Ein Zwölffamilienhaus erfordert ebenfalls viel Planungsarbeit und Aufmerksamkeit, oft sogar mehr pro Wohneinheit als bei einem Grossprojekt.
Die Nachfrage in Zürich ist am grössten, der Leerwohnungsbestand im Kanton liegt bei einem halben Prozent.
Wir haben kürzlich eine Wohnüberbauung mit 150 Wohnungen in der Region Zürich fertig gestellt. Nach Vermietungsbeginn erhielten die Vermieter innert kürzester Zeit 600 Anmeldungen für diese Wohnungen. Diese Interessenten reichten diverse Unterlagen wie Strafregisterauszug und Einkommensnachweis ein. Nach diesem ersten Auswahlprozess blieben noch immer 450 potenzielle Mietinteressenten. Wer schliesslich den Zuschlag erhält, muss drei Monatsmieten als Depot hinterlegen. Auch bei einer anderen Wohnüberbauung, die wir gerade für einen institutionellen Investor fertiggestellt haben, sind alle 250 Wohnungen vor dem erstmöglichen Bezugstermin vermietet worden. Dabei sind die Mietzinsen aus Ostschweizer Optik äusserst hoch.
Das befeuert die Diskussion, ob man günstigen Wohnraum fördern soll.
Meine Meinung ist klar: Dort, wo wir keine Mehrausnutzung in einer Überbauung haben, sollte der Vermieter eine Marktmiete verlangen können – also das, was bezahlt wird. Dort, wo eine Mehrausnutzung zulässig ist, zahlen die Bauherren bereits eine Mehrwertabgabe, dafür gibt es klare Berechnungsgrundlagen. Bei solchen Überbauungen könnte man bis zu einem Drittel der Einheiten als preisgünstige Wohnungen gestalten.
Wer trägt die Differenz?
Die Differenz trägt der Investor, denn rechnerisch hat dadurch das Land weniger wert.
Das Ausstattungsniveau der Wohnungen bleibt aber gleich?
Es ist möglich, den Bau etwas anzupassen. In der Schweiz haben wir uns an einen sehr hohen, zu hohen Standard gewöhnt. Jedes Detail ist elektrifiziert, das verteuert eine Wohnung. Dazu kommen dann noch alle Nachhaltigkeitskriterien. Brauchen wir das alles? Am Schluss kostet das mehr, und das wird alles auf die Miete aufgeschlagen.
Wer es sich leisten kann, bezieht auch eine grössere Wohnung.
Auch dadurch erhöht sich die Nachfrage. Wir nutzen heute im Schnitt rund 45 Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf. Das ist im europäischen Vergleich hoch. In einer Krise geht als erstes der Verbrauch an Wohnfläche pro Kopf zurück, weil man zu mehr Kompromissen bereit ist und buchstäblich zusammenrückt.
Zusammenrücken müssen wir auch, weil mehr Leute denselben, endlichen Platz beanspruchen.
Ob wir wollen oder nicht, wir gehen auf die «Zehn-Millionen-Schweiz» zu. Wir können nicht weiter einzonen, und mehr Platz haben wir nicht. Folglich müssen wir das Bauland, das eingezont ist, viel wirtschaftlicher nutzen. Das heisst Verdichtung.
«In der Schweiz haben wir uns an einen sehr hohen, zu hohen Standard gewöhnt.»
Ein logischer Ansatz, doch die Umsetzung ist schwierig.
Wir müssen das verfügbare Land flexibler nutzen. Zu den Arealen, die wir entwickeln, gehören auch grosse Industrieareale. Da gäbe es viele Möglichkeiten für die Nutzung, doch ist das entsprechende Land meistens einer Industriezone zugeteilt. Wenn wir daraus ein lebendiges Quartier gestalten wollen, müssen wir jedoch in der Lage sein, verschiedene Nutzungsmöglichkeiten anzubieten. Ebenso sollten wir die vielen Gewerbezonen in der Schweiz anschauen. Oft befinden sich dort Firmen, deren Lärmbelastung für die Umgebung inzwischen so gering ist, dass man problemlos daneben Wohnungen oder Büros bauen könnte. Mit einer solchen Durchmischung entstehen vielfältige Areale, die auch leben. Unsere Zonenplanung lässt das praktisch nicht zu. Mit den Sondernutzungsplänen gibt es nun aber ein Instrument, das mehr unterschiedliche Nutzungen zulässt. Ich hoffe, dass die Gemeinden bei der Überarbeitung ihrer BZO die Vorschriften für die einzelnen Zonen flexibler gestalten, damit verschiedene Nutzungen in der gleichen Zone möglich werden.
In welchen Kantonen machen Sie die besten Erfahrungen?
Das kann man nicht kantonal vergleichen, man muss es auf Gemeindeebene beurteilen, weil eine Gemeindebehörde sehr viele Einflussmöglichkeiten hat. Ein sehr gutes Beispiel haben wir bei einer Projektentwicklung mit der Gemeinde Goldach gemacht. Und auch die kantonalen Behörden von St.Gallen haben an diesem Industrieprojekt sehr gut, äusserst speditiv mitgearbeitet.
Dass St.Gallen etwas besser macht als Zürich ist auch ein Highlight.
Der Kanton Zürich wirkt tatsächlich bei weitem nicht so gut organisiert. Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, wenn Zürich einen Koordinator für die diversen Abteilungen hätte. Strenge Vorschriften und eindeutige Regeln sind uns lieber, als wenn wir mit einem «wir schauen mal» arbeiten müssen. Klarheit ist wichtig.
St.Gallen ist also besser organsiert?
Meiner Meinung nach hat St.Gallen auch Schwächen. Beispielsweise wenn es um Wettbewerbe und deren Einladungen geht, da ist St.Gallen sehr kompliziert und Zürich wieder einfacher.
Kompliziert aufgrund widersprüchlicher Vorschriften?
Nehmen wir ein alltägliches Beispiel. Ein Amt fordert, dass ein Dach einer Überbauung zu 100 Prozent mit Solarpanels ausgerüstet wird, ein anderes Amt schreibt eine vollständige Dachbegrünung vor. Man könnte also theoretisch erhöhte Solarpanels über einer Begrünung konstruieren, doch das sähe ästhetisch nicht sehr vorteilhaftaus und der Unterhalt der Dachbegrünung wäre schwierig. Eine solche Lösung ist nicht sinnvoll.
Bei jeder Überbauung wird auch um die Parkplätze gefeilscht.
In St.Gallen wie in Zürich haben die Behörden das Gefühl, den Individualverkehr brauche es nicht mehr. Dem ist aber nicht so. In Zürich kann ich von unserem Büro aus viele Orte in der Stadt und Agglomeration mit dem Tram erreichen. Ich muss nicht auf den Fahrplan schauen, die Trams fahren im Fünf-Minuten-Takt. In St.Gallen ist der ÖV längst nicht so gut ausgebaut. Aus diesem Grund kann man nicht vorschreiben, dass pro Wohnung nur noch ein halber Parkplatz gebaut werden darf. Das funktioniert nicht, ausser man ist direkt im Zentrum.
Mettler Entwickler AG
Die Mettler Entwickler AG, mit Hauptsitz in St.Gallen und Niederlassungen in Zürich, Kemptthal und Basel, ist in der ganzen Deutschschweiz tätig. Das Unternehmen mit fast 50 Mitarbeitern entwickelt Areale und projektiert und realisiert sowohl Wohnüberbauungen wie auch Gewerbe- und Industrieflächen.
Text: Philipp Landmark
Bild: Marlies Beeler Thurnheer