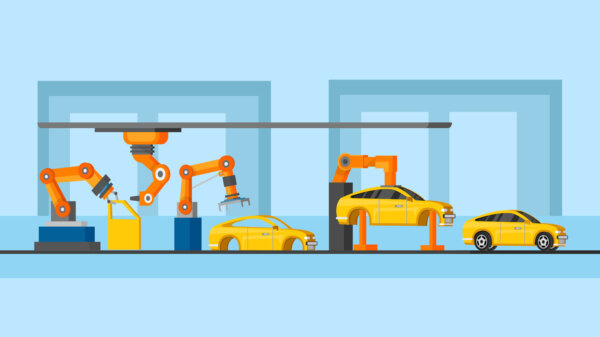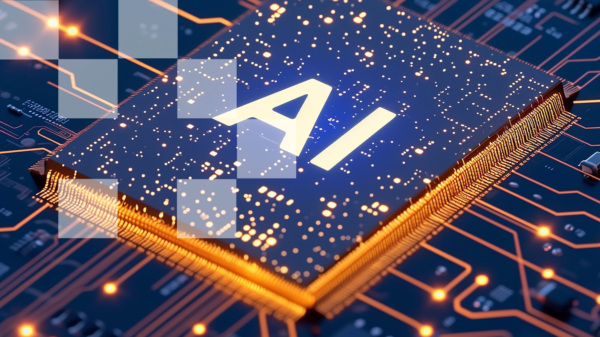Willkürliche Einsprachen sollen kosten

Ja, es gibt zu wenig Wohnraum, sagt Andreas Pfister. «Aber wir müssen zwischen der Situation in Zürich und bei uns in der Ostschweiz unterscheiden.» Pfister verweist auf die Leerstandquoten für das Jahr 2024: Da lag der Kanton St.Gallen bei 1,39 Prozent, die Stadt St.Gallen sogar bei 2,1 Prozent. Im Kanton Zürich lag diese Ziffer bei 0,56 Prozent, in der Stadt Zürich bei 0,07 Prozent. «Das sind zwei komplett verschiedene Welten.»
Eine auch medial stark rezipierte Wohnungsnot wie in Zürich gibt es hier also nicht, «für mich ist der Blick nach Zürich aber dennoch interessant – nur schon, um zu sehen, was bei uns noch passieren könnte», sagt Andreas Pfister. Wenn Wohnraum sehr knapp werde, würden Fragen rund um die Bereitstellung von Wohnraum schnell zu Reizthemen, die Preise stiegen stark und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wachse. «Die unmittelbare Folge ist dann der vermehrte Ruf nach Marktregulierung und nach staatlicher Bereitstellung von Wohnraum. Die Politik nimmt diesen Spielball gerne auf und produziert Wohnraumvorlage um Wohnraumvorlage.»
Von solcherlei Aktivismus hält Pfister nichts. «Abhilfe gegen einen Mangel an Wohnraum und den damit verbundenen Preissteigerungen schafft letztlich nur eine Ausweitung des Angebots. Das wird aufgrund der aktuell vorherrschenden Planungs- und Staatsgläubigkeit aber gerne übersehen. Die Schweizer Immobilien-Investoren sind sehr wohl in der Lage, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Nur fehlen zurzeit die richtigen Rahmenbedingungen.»
«Die Stadt St.Gallen hat mit 2,1 Prozent eine der schweizweit höchsten Leerstandquoten.»
«Situation verschärft sich»
Zustände wie in Zürich sieht man im Kanton St.Gallen bislang nicht. Das Muster des Bevölkerungswachstums folge hier recht genau dem Schweizer Schnitt, stellt Andreas Pfister fest: In der Schweiz wuchs die Bevölkerung 2023 um 1,7 Prozent und 2024 um 1,0 Prozent, im Kanton St.Gallen lagen die Werte bei 1,7 Prozent und 0,9 Prozent.
Gleichzeitig nimmt die Quote der Leerstände auch im Kanton St.Gallen deutlich ab: «Wir sind längst nicht so weit wie Zürich, aber die Situation verschärft sich auch hier.» Wäre die Wohnraumproduktion genügend, «dann würden wir das Bild der sinkenden Leerstände nicht sehen. Dann könnte das Angebot die Nachfrage bedienen», sagt Pfister. «Das ist aber auch in der Ostschweiz nicht mehr so.»
Ideal wäre eine Leerstandquote von etwa einem Prozent, wie Pfister bestätigt: «Mit einem Prozent sind so ziemlich alle Beteiligten happy. Darunter, bei einem halben Prozent, wird es ungemütlich. Der Kanton Zürich hat das schon, das ist extrem.» Auffällig ist: In der Stadt Zürich gibt es eigentlich keine freien Wohnungen mehr, die Stadt St.Gallen zeigt dagegen das umgekehrte Bild. «Die Stadt St.Gallen ist ein Spezialfall und ein unrühmliches Beispiel für eine mangelhafte Standortpolitik», betont Andreas Pfister. «Die Stadt St.Gallen hat mit 2,1 Prozent eine der schweizweit höchsten Leerstandquoten – interessanterweise bewegt sich diese auch kaum nach unten.» Gleichzeitig bewegt sich die Bevölkerungszahl in der Stadt St.Gallen nur sehr zögerlich nach oben: Es fehlt offensichtlich die Nachfrage, währenddessen die Ostschweiz rundherum wächst. Also meidet man die Stadt? «Ja», sagt Andreas Pfister. Er verweist nochmals auf die Leerstandziffern: Noch 2018 lag der Kanton St.Gallen bei 2,2 Prozent, jetzt liegt er bei 1,39 Prozent. «Im Kanton ist eine Dynamik erkennbar, in der Stadt läuft sehr wenig.»
Wohnungen in schlechtem Zustand
Eine etwas höhere Leerstandziffer müsste nicht per se schlecht sein, gibt Andreas Pfister zu bedenken. «Das ist für einen Standort gar nicht so unattraktiv. Das bedeutet ja, dass Zuzüger innert nützlicher Frist eine Wohnung finden.» Wenn denn diese Wohnungen einem gewissen Standard entsprächen. «Wer auf den verschiedenen Immobilienportalen nachschaut, was an Mietobjekten frei ist, findet in St.Gallen viele Altbauwohnungen, oft in einem schlechten Zustand, aber trotzdem relativ teuer.» Das Wohnungsangebot in St.Gallen sei trotz vermeintlicher Auswahl alles andere als gut: «Der Gebäudepark hat einen enormen Nachholbedarf, was Sanierungen angeht.»
Das gelte nicht nur für Mietwohnungen, im Fall der Stadt St.Gallen gelte das tatsächlich auch für Wohneigentum, sagt Andreas Pfister. «Es gibt hier nur ganz wenige attraktive Projekte für Eigentumswohnungen.» Das wiederum bedeutet, dass insbesondere Wohnungen für Leute fehlen, die vielleicht auch etwas mehr zum Steuersubstrat beitragen würden. «Wenn beispielsweise gut situierte ältere Leute vom Land in die Stadt ziehen möchten und eine zentrale, mit ÖV bediente attraktive Eigentumswohnung suchen, finden sie kein passendes Angebot.»
«Da bringt man auf einem kleinen Flecken sehr viel Wohnraum hin. Solche Vorhaben müssten öfter gelingen.»
Bautätigkeit wird gebremst
Sowohl bei den Mietwohnungen als auch bei den Eigentumswohnungen kann das Angebot die Nachfrage nicht befriedigen, also müsste es eigentlich attraktiv sein, in neue Projekte zu investieren. «Projektieren ist heute sehr viel zeitaufwendiger geworden», erklärt Pfister, «die Bewilligungsverfahren dauern sehr lange, und es gibt unglaublich viele Vorschriften.» Dadurch werde die Bautätigkeit stark gebremst.
Neuere, sehr strenge Lärmschutzvorschriften sind eines dieser Hindernisse. «Ein ganz schwieriges Thema», bestätigt Pfister, «da bewegt sich aber wenigstens etwas auf Bundesebene – die Vorschriften sollen abgeschwächt und entschärft werden. Das könnte viel helfen.»
Ein anderes Problem, das Bauen komplizierter mache, sei der Ortsbildschutz, «darüber hinaus gäbe es eine ganze Liste an weiteren Vorschriften». Doch es sei nicht nur die Öffentliche Hand mit ihren Vorschriften, die das Bauen schwierig mache: «Es ist auch die ganze Einsprache-Situation.» Es komme fast nie vor, dass ein Neubau errichtet werde, ohne dass es zuvor Einsprachen gab. «Eine Einsprache zu erheben, ist sehr einfach, wohl zu einfach», sagt Andreas Pfister. «Es gibt kaum grosse Anforderungen und ist für die Einsprecher nicht mit einem finanziellen Risiko verbunden. Wird der Instanzenweg beschritten, kann das bei einem Bauprojekt zu jahrelangen Verzögerungen führen.»
Die Flut an Einsprachen gegen fast alle Projekte gibt es auch, weil eine Einsprache mit keinerlei Risiko verbunden sei. «Es wäre allen gedient, wenn man hier die Schrauben etwas anziehen könnte», sagt Pfister. «Die Rechtsmittel sollen weiterhin bestehen bleiben, doch ihre exzessive Nutzung muss zurückgebunden werden. Wir müssen verhindern, dass Leute aus einer reinen Ablehnungshaltung eine Einsprache gegen ein Projekt machen. Eine Einsprache sollte sich nur lohnen, wenn an einem Projekt tatsächlich etwas nicht stimmt.» Pfister wünscht sich deshalb, dass willkürliche Einsprachen finanzielle Konsequenzen für die Einsprecher hätten.
«Wenn jemand eine Einsprache gegen ein Projekt macht, das grundsätzlich sämtlichen Vorschriften entspricht, müsste für den Fall, dass er unterliegt, ein finanzielles Risiko eingehen. Beispielsweise, indem ein im Voraus entrichteter Betrag einbehalten wird.»
Auch interessant
«Verdichtung ist der richtige Weg»
Das revidierte Raumplanungsgesetz gibt vor, dass zusätzlicher Wohnraum hauptsächlich über Verdichtung zur Verfügung gestellt werden soll. «Darüber haben wir 2013 an der Urne abgestimmt, alle finden das einen guten Ansatz – nur nicht vor dem eigenen Haus», sagt Andreas Pfister. «Wer selbst betroffen ist, wehrt sich mit allen Mitteln.» Auf städtischem Gebiet sei es deshalb sehr schwierig, eine echte Verdichtung zu erreichen. Die Idee im Raumplanungsgesetz scheitere also in gewisser Hinsicht an der Realität.
Von der Idee an sich ist Pfister überzeugt: «Die Fläche, die uns zur Verfügung steht, ist endlich. Darauf müssen wir aber immer mehr Menschen unterbringen.» Verdichtung sei absolut der richtige Weg. «In städtischen Gebieten gibt es Verkehrswege, die ganze Infrastruktur ist schon da. Es ergibt keinen Sinn, die ohnehin spärlich vorhandene Grünfläche zu überbauen, wenn man in den Städten viel mehr herausholen könnte.» Ein positives Beispiel, wie dies geschehen könnte, findet Pfister in der Stadt St.Gallen: das geplante Hochhaus an der Bogenstrasse bei der Kreuzbleiche. «Da bringt man auf einem kleinen Flecken sehr viel Wohnraum hin. Solche Vorhaben müssten öfter gelingen.» Denn: «Auf dem Land findet sich vielleicht noch eine grüne Wiese zum Bebauen, in der Stadt gibt es das kaum mehr.»
Doch gerade bei einem Vorhaben wie dem Hochhausprojekt können sehr viele Leute mitreden, neben Überbauungsplänen gibt es auch Mitwirkungsverfahren. So gibt es sehr viele Hindernisse zu überwinden, bis die Bagger auffahren können. «Das muss einfacher werden», fordert Andreas Pfister. «Ich will nicht gänzlich auf all die Rechtsmittel verzichten, aber im Moment haben diese ein zu grosses Gewicht. Das macht es für Investoren unattraktiv, neue Projekte voranzutreiben.» Die Planung dauere immer länger, der Aufwand werde immer teurer, und der Ausgang des ganzen Planungsprozesses bleibe sehr ungewiss.
Lange passiert einfach nichts
Wohnraum ist in der ganzen Ostschweiz knapp, das Problem der Stadt St.Gallen sticht jedoch speziell heraus. Soll es hier zu einer Trendwende kommen, soll mehr und vor allem besserer Wohnraum entstehen, dann müssten sich auch die Behörden auf jeder Stufe dieses Ziel an die Fahne heften. «Ich will nicht sagen, dass sie nichts tun, aber sie müssten es wesentlich beherzter tun», betont Andreas Pfister.
Ein unrühmliches Beispiel in der Stadt ist die Ruckhalde. 2018 wurde die dortige enge Zahnradkurve der Appenzeller Bahnen in einen Tunnel verlegt, seither wäre der Hang endgültig frei für eine Überbauung. Eine Idee übrigens, die nicht neu ist, das St.Galler Tagblatt berichtete gerade über Überbauungspläne aus dem Jahr 1907, die in einem Archiv gefunden wurden. «Bei der Ruckhalde ist die Stadt am Drücker, aber es ist sehr lange nichts passiert», sagt Pfister. «Dabei wäre das attraktiver Wohnraum, da könnte man etwas wirklich Spannendes realisieren.»
Fokus auf Mietwohnungen
Die Max Pfister Baubüro AG wurde 1933 gegründet. Das Familienunternehmen vermietet rund 1400 Wohnungen in der Stadt St.Gallen, in Gossau und in Rorschach. Ein kleiner Anteil Gewerbeliegenschaften ergänzt den Immobilienbestand. «Pfister-Wohnungen» sind über Jahrzehnte zu einem Synonym für bezahlbare, aber qualitativ gute Wohnungen geworden. CEO Andreas Pfister, der das Unternehmen in dritter Generation führt, möchte die Wohnungen wie einen VW Golf bei Autos positioniert wissen: «Erschwinglich, gute Qualität, guter Service.» Dafür sorgen rund 90 Mitarbeiter, das Unternehmen hat ein eigenes Baugeschäft, eigene Gärtner, eigene Maler und vollamtliche Hauswarte. Wenn eine Liegenschaft eine umfassende Sanierung benötigt und während der Sanierung nicht bewohnt bleiben kann, wird nicht einfach allen Mietern gekündigt. Das sei Usanz, betont Andreas Pfister: «Die Max Pfister Baubüro AG spricht nie Leerkündigungen aus.» Bei einem bevorstehenden Sanierungsvorhaben informiere die Vermieterin so früh wie möglich. «Wir treten mit den Mietern in Kontakt und suchen nach Lösungen», sagt Andreas Pfister. «Meistens haben wir die komfortable Situation, dass wir Leute innerhalb unseres Bestands umplatzieren können. Dann sind auch Pfister-Wohnungen, die darum preislich in einem ähnlichen Bereich liegen.» Wenn die Vermieterin einen guten zeitlichen Vorlauf hat, vermietet sie in der jeweiligen Siedlung Wohnungen nicht mehr neu. «So ergeben sich bereits ein paar Leerstände, und wir können den Leuten innerhalb der gleichen Siedlung eine Alternative bieten.»