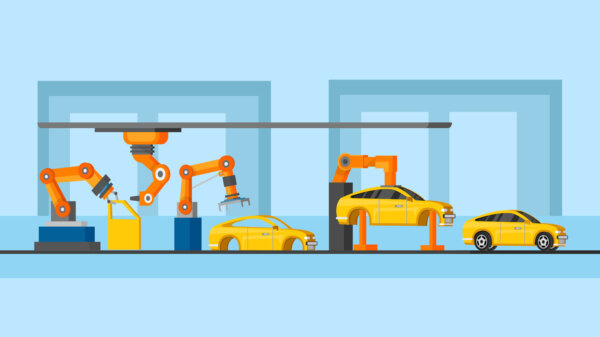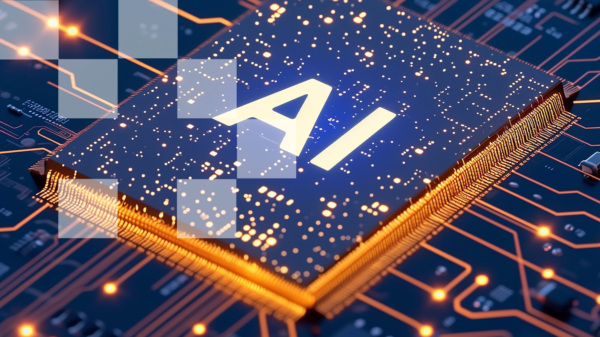Frieden für die nächste Generation

Louis Grosjean, Sie tragen eigentlich keinen typischen Ostschweizer Namen. Wie kommt es dazu, dass Sie Ostschweizer Familien begleiten?
Da haben Sie recht! Ich komme ursprünglich aus Neuenburg und stamme aus einer Winzerfamilie. Mit 18 bin ich für das Studium in die Ostschweiz «ausgewandert». Ein paar Jahre später habe ich meine Frau Tina kennengelernt – eine heimatverbundene Appenzellerin. Und so haben wir unsere Familie hier gegründet. Das hat mich aber nicht daran gehindert, meine Wurzeln weiterhin zu pflegen. Das Weingut in Neuenburg ist mittlerweile in den Händen meines Bruders. Das musste familienintern geregelt werden. Mich erfüllt es bei jedem Besuch mit Freude, dass er den Betrieb erfolgreich weiterführt.
Ein Wahl-Ostschweizer also. Welche typischen Werte haben aus Ihrer Sicht Ostschweizer Familien?
Zwischen West- und Ostschweiz gibt es kaum Unterschiede. Vielleicht wird die individuelle Verantwortung gegenüber dem Schutz durch die Gemeinschaft in der Ostschweiz etwas stärker betont. Wie überall auf der Welt wollen Eltern in der Ostschweiz nur das Beste für ihre Kinder. Ihnen ist wichtig, dass es keinen Streit gibt – weder jetzt noch später, wenn die Eltern nicht mehr da sind.
Damit wären wir beim Frieden. Welche Konfliktursachen beobachten Sie oftmals in Familien, wenn es um die Weitergabe von Vermögen geht?
Es fängt mit Transparenz an. Wenn Eltern wollen, dass das Haus an die Tochter und die Wertschriften an den Sohn gehen, dann ist es gut, wenn man dies offen in der Familie kommuniziert. Um bei diesem Beispiel zu bleiben: Auch wenn das Haus und die Wertschriften gleich viel wert sind, wird sich der Sohn vielleicht fragen: Warum bekomme ich nicht das Haus, in dem ich aufgewachsen bin? Gefühle der Bevorzugung, Vernachlässigung oder empfundenen Geringschätzung kommen oft erst im Erbfall an die Oberfläche. Sie werden meistens nicht direkt als solche geäussert, sondern in Form von Geldansprüchen.
«Gefühle der Bevorzugung oder Geringschätzung kommen oft erst im Erbfall an die Oberfläche.»
Wer emotional zu kurz gekommen ist, hegt oft den Verdacht, dass Miterben bevorzugt werden? Ganz genau. Da treffen sich Recht, Finanzen und Psychologie in den Aufgaben des Beraters. Schliesslich gibt es handfeste Konstellationen, die typisch für spätere Konflikte sind – zum Beispiel die Weitergabe des Elternhauses zu einem «Familienpreis» an einen Nachkommen oder die eigenmächtige Räumung der Erblasserwohnung durch einen Erben.
Welche Instrumente gibt es, um die Weitergabe des eigenen Vermögens zu regeln?
Ein Teil des Vermögens kann bereits zu Lebzeiten weitergegeben werden. Man spricht in diesem Zusammenhang von Schenkung oder Erbvorbezug. Wird das Vermögen erst mit dem Tod weitergegeben, so greifen die erbrechtlichen Instrumente: Testament, Erbvertrag oder – für Ehepaare – der kombinierte Ehe- und Erbvertrag.
Schenkung ist ein gutes Stichwort: Lange bevor Eltern versterben, schenken sie oft ihren Kindern Geld, ein Auto, eine Immobilie oder Anteile einer Firma. Kann das zu Problemen führen?
Überweisen die Eltern einfach Geld auf das Konto ihrer Kinder, so ist der Betrag bekannt. Ein schriftlicher Nachweis von Schenkung und Schenkungsabsicht wird reichen. Etwas besser muss ein Erbvorbezug dokumentiert werden, wenn es um Firmenanteile oder eine Immobilie geht. Dann braucht es einerseits einen Kauf- bzw. Schenkungsvertrag, andererseits aber auch die erbvertragliche Regelung, welcher Betrag (Schenkungsanteil) beim Erbgang des Schenkers dem beschenkten Erben anzurechnen ist.
Können Sie ein Beispiel geben?
Gerne: Eltern verkaufen eine Immobilie an einen Nachkommen zum Steuerwert. Im Erbrecht gilt jedoch der Marktwert. Die Differenz kann zu Ausgleichungsansprüchen im Erbfall führen, wenn nichts geregelt ist. Zudem wird eine Wertzu- oder -abnahme der Immobilie zwischen Schenkung und Erbgang angerechnet. Das regelt man besser zum Schenkungszeitpunkt als nach dem Tod.
Muss denn alles schriftlich geregelt werden? Wir leben doch von der Handschlag-Mentalität, besonders in der KMU-Welt.
Für die Kommunikation gilt keine rechtliche Form – zum Glück. Es ist gut, wenn die Familie transparent weiss, was mit dem Vermögen der Eltern bei ihrem Hinschied geschehen soll. Das sollen die Eltern nach Möglichkeit frühzeitig ihren Kindern mitteilen. Wenn es aber um die verbindliche Regelung der Vermögensweitergabe geht, so sind die erbrechtlichen Formen einzuhalten. Erbverträge sind notariell vor zwei Zeugen zu beurkunden; Testamente sind handschriftlich zu verfassen, mit Datum und Unterzeichnung, oder ebenfalls notariell vor zwei Zeugen zu beurkunden. Wird die rechtliche Form nicht eingehalten, ist das Dokument im Konfliktfall nicht durchsetzbar.
Gibt es auch Eltern, die ihre Kinder ungleich behandeln wollen?
Das gibt es, wenn auch nicht allzu oft. Die Gründe können verschieden sein: finanzielle oder gesundheitliche Schwierigkeiten eines Kindes, Übernahme des elterlichen Betriebs ohne Ausgleichsmöglichkeiten oder gestörte Eltern-Kind-Beziehungen. Als Berater empfehle ich immer Lösungen, die das Konfliktpotenzial reduzieren. Letztlich entscheidet jedoch der Kunde.
Auch interessant
«Es gibt drei Hauptgründe für eine aktive erbrechtliche Regelung: Kinder, Immobilien oder ein Unternehmen.»
Kommen immer die Eltern zu Ihnen oder auch mal die Nachkommen?
Es passiert ab und an, dass Nachkommen mit mir Kontakt aufnehmen – etwa, weil die Eltern nichts kommuniziert haben und die Kinder ihre Rechte kennen wollen. Oder weil sie eine Fachperson beiziehen möchten, um die Eltern zu überzeugen. Letzteres ist selten zielführend: Die Weitergabe des eigenen Vermögens ist eine persönliche Sache. Die Verantwortung dafür muss die betreffende Person selber tragen.
Die Erbschaft ist geplant. Ist Ihre Aufgabe dann abgeschlossen?
Nein, meistens nicht. Denn oft wollen Familien, dass die Person, die den Plan aufgesetzt hat, diesen auch umsetzt. Der Berater wird nach dem Tod häufig zum Willensvollstrecker.
Nach dem Todesfall gibt es vieles zu erledigen. Was sind die wichtigsten Etappen?
Zuerst kommt die Trauerphase. Sich sofort in administrative und rechtliche Themen zu stürzen, ist nicht zielführend. Danach folgt die Inventaraufnahme, die Steuererklärung per Todestag und die Verwaltung des Nachlasses. In dieser Phase fallen viele administrative Schritte an, zum Beispiel mit Grundbuchämtern oder Banken. Dann kommt die Erbteilung – primär anhand der Regelungen des Erblassers, im Übrigen gestützt auf die Entscheide der Erben, die einstimmig gefällt werden müssen.
Was ist besonders zu beachten, wenn ein Unternehmen im Nachlass ist?
Bei inhabergeführten Familienunternehmen sollte die Weitergabe zu Lebzeiten erfolgen. Es braucht tatkräftige Hände, um Unternehmen zu führen. Kommt der Tod zu früh, muss klar geregelt sein, wer operative Aufgaben übernimmt. Zeichnungs- und Bankberechtigungen sind vorgängig einzurichten. Bei Einzelaktionären, die zugleich Einzelverwaltungsräte sind, kann der Tod ohne Vorkehrungen zur operativen Paralyse führen. Sind mehrere Aktionäre vorhanden, empfiehlt sich ein Aktionärsbindungsvertrag mit klaren Regelungen.
Haben Sie einen Tipp zum Schluss?
Viele Erbschaften werden friedlich gelöst. Das funktioniert bei guten Familienverhältnissen. Wird es jedoch stürmisch, ist es gut, die erbrechtlichen Themen vorher geregelt zu haben. Es gibt drei Hauptgründe für eine aktive erbrechtliche Regelung: Kinder, Immobilien oder ein Unternehmen. Je mehr Gründe zutreffen, desto wichtiger ist es, zu handeln.
Text: Stephan Ziegler
Bild: zVg