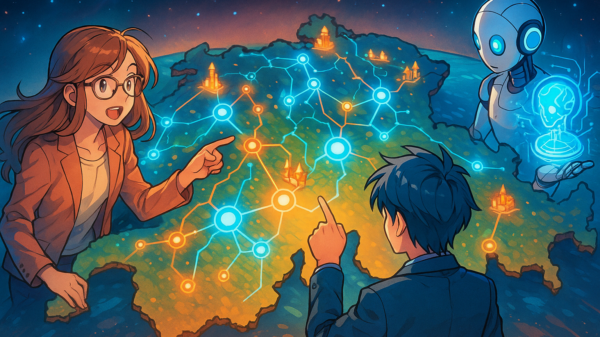Ideen verbinden Ufer

Text: PD/stz.
Die 70 Teilnehmer arbeiteten in fünf Fokusgebieten an konkreten Zukunftsbildern für die grenzüberschreitende Region. Die Ateliers lagen beidseits des Rheins, etwa im denkmalgeschützten Bahnhofsaal und im Bürgersaal des Rathauses der beiden Rheinfelden. Die tägliche Grenzüberschreitung wurde dadurch schnell ein gelebter Teil der Sommerakademie und die Aufgabe war keine einfache: «Industrie, Naturschutz, Siedlungsentwicklung, Mobilität und Erholungsangebote müssen zukunftsfähig und für eine bessere Lebensumwelt zusammengedacht und geplant werden», sagt Co-Leiterin Prof. Andrea Cejka der OST – Ostschweizer Fachhochschule.
Nach drei intensiven Tagen gab es in der Industriehalle des Buss-Areals in Pratteln erste Zwischenpräsentationen der Konzepte, bevor die Teams nach zwei weiteren Tagen konzentrierter Arbeit ihre Ergebnisse in einer öffentlichen Ausstellung auf dem Idi-Furrer-Platz in Rheinfelden (CH) präsentierten. «Bereits am Abend bei der ersten Reflexion war spürbar, wie viel Energie die Studenten und jungen Fachleute in die Themen einbringen. Ein Eindruck, der sich in den kommenden Tagen nur noch verstärkte», sagt Co-Leiter Dr. Andreas Nütten von der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW).
Lernen im Dialog: Was das Format leistet
Begleitet wurden die Studenten und jungen Fachleute von Dozenten, politischen Vertretern aus der Region sowie verschiedenen Experten in den Fokusgebieten. Die Sommerakademie wurde dadurch Fach-Werkstatt und Resonanzraum zugleich, bei dem nicht nur die angehenden Fachleute mit jedem Tag mehr Begeisterung zeigten.
Dr. Carlo Becker, Landschaftsplaner, Experte und Erfinder des Begriffs Schwammstadt in Europa sowie Impulsredner, betont: «Das Format der Sommerakademie ist sehr kreativ – der Austausch zwischen den Studenten mit ihren Ideen und den Experten mit ihren Realitätschecks ist vielversprechend.» Co-Leiterin Prof. Andrea Cejka hebt hingegen das dynamische Lernen hervor: «Die Sommerakademie ist ein sehr dynamisches und freies Format, in dem neue Vorgehensweisen ausprobiert werden dürfen. Dabei geht es um systemisches Entwerfen in grossen Räumen, also mit räumlichen Sichtweisen aus dem Wert der Landschaft heraus.»
Auch aus der Region kam Rückenwind. Françoise Moser, Präsidentin Regionalplanung Fricktal, erinnert an die Aufgabe, Menschen mitzunehmen: «Viele Menschen an Gemeindeversammlungen haben Ängste, Wandel wird nicht immer sofort positiv bewertet.» Den Studenten dankt sie für ihr Engagement, mit neuen Konzepten positive Zukunftsvisionen zu schaffen.
Ein Raum in Bewegung
Im Fokusgebiet «Landschaftspark 2.0» (Möhlin–Rheinfelden/Baden) wurden Agroforst, eine Renaturierung des Möhlinbachs, Wildtierkorridore und die Flutung einer Kiesgrube vorgeschlagen; kombiniert mit lokaler Kreislaufwirtschaft (Biogas, reaktivierte Aquaponik) und einem Treffpunkt an Velorouten-Knoten. Andere Teams setzten auf Schutz, Wege und Bildung. Etwa ein «Landschaftsquartett», andere interpretierten den Raum als «Allmend 2.0» mit erlebbarer Ernährungslandschaft.
Auch die internationale Doppelstadt Rheinfelden (DE/CH) wurde neu gedacht: von der «Rheintrilogie» mit einem dritten, rheinfokussierten Zentrum über das Motto «ver-rhein-en» (ein blau-grünes Band am Rhein mit stärkeren Uferwegen, Veloverbindungen und ÖV) bis zu «Zusammenstadt statt alleine» mit fünf Leitlinien: Identität, Verbindung, Lebensqualität, Abhängigkeit und Beteiligung.
Im «Historischen Palimpsest» (Augusta Raurica) reichten die Ideen von vertikalen Verbindungen im 15-Minuten-Raum über eine neue Brücke Augst–Kaiseraugst bis zu «grünen Adern», die verstreuten Zeugnisse der Römerstadt zu einem erlebbaren Ganzen verknüpfen.
Im «Rheindialog» (Grenzach-Wyhlen–Pratteln) wurden eine neue Brücke, die Aktivierung leerstehender Gewerbeflächen, «Arenen des Dialogs» als Beteiligungsformate und die Stärkung grüner Vernetzungen skizziert.
Das Projekt «Industrie und Wald» (Birsfelder Hafen/Hardwald) fokussierte auf Abkühlung und Revitalisierung – von Grau zu Grün – mit grünen Fingern in die Quartiere, Schwammstadt-Typologien, Gebäudebegrünung, Pufferzonen und verbesserten Zugängen zum Rhein. Ein zweiter Ansatz setzte auf iteratives Lernen: erkunden, testen, auswerten, umsetzen inklusive einer positiven Zukunftsvision: vom «Boulevard of broken dreams» zum «Boulevard of happy dreams».
Auch interessant
Motivation und Grenzerfahrungen
Direkt befragt, zeigten die Studenten, dass sie nicht nur fachlich und kulturell unterschiedliche Hintergründe mitbringen, sondern auch die Hochrhein-Region ganz unterschiedlich bewerten und ihre Teilnahme an der Sommerakademie mit ganz individuellen Zielen verbunden haben. Studentin Sina Brandt (TU Dortmund) sagt: «Zur Teilnahme motiviert hat mich die länderübergreifende Zusammenarbeit. Grenzregionen sind besonders spannend, denn sie bieten eine besondere Art, wie Bewohner den Raum nutzen und wie sie sich im Raum bewegen.»
Lea Rudolph (Hochschule Osnabrück) betont den Mehrwert des Austauschs: «Meine Erwartungen an die Sommerakademie bestätigen sich: Alles ist sehr gut konzipiert und die Gespräche mit den Experten sind sehr hilfreich.» Philipp Gerster (Ostschweizer Fachhochschule) fasst die Dynamik so zusammen: «Am meisten gebracht hat mir der interdisziplinäre Austausch in einem Umfeld voller Studenten. Man will für seine Ideen kämpfen. Die unterschiedlichen Prioritäten der verschiedenen Professionen werden aufgezeigt. Wir hatten hitzige und produktive Diskussionen.»
Hochrhein als Gemeinschaftsaufgabe
Konkrete, teilweise sehr aufwendig gestaltete Grafiken und Visualisierungen machten die Vorschläge der interdisziplinären Teams greifbar: ein Park- und Produktionsraum, in dem Landwirtschaft, Industrie und Gesellschaft im Reallabor zusammendenken; rheinseitige Stadtparks als blau-grünes Band; grüne Korridore in überhitzten Hafen- und Logistikarealen; neue Brücken und beruhigte Zentren für kurze Wege; Lern- und Beteiligungsarenen, die den Dialog verstetigen.
Oder mit den Worten von Dr. Carlo Becker: «Der Hochrhein ist eine Gemeinschaftsaufgabe – der Gemeinden, Wirtschaft, Umwelt, Industrie, Schifffahrt und weiterer Akteure. Meine Botschaft an die Politiker sowie Planungsverantwortlichen ist: Sie müssen sich in den nächsten drei Monaten unbedingt mindestens drei Mal treffen, um die Ideen zu reflektieren und gemeinsame Projekte auf den Weg zu bringen.»
Ausstellung, Netzwerke, nächste Schritte
Die Sommerakademie baut Brücken über Disziplinen und Ufer hinweg – und stärkt die Umsetzungskultur. Garry Müntener (Kanton Basel-Landschaft) zeigt sich zuversichtlich: «Ich bin überzeugt, dass es daraus neue Projektideen geben wird… Ich möchte bald damit beginnen, Dialogmöglichkeiten zu schaffen.»
Für Dr. Daniel Kolb (Kanton Aargau) ist die Akademie zugleich Nachwuchsförderung: «Es geht hier auch darum, junge Studenten für die Raumplanung zu begeistern.» Potenzial hätten alle Ideen, «die Grenzüberschreitung ermöglichen, intensivieren und verstärken».
Mit der Wanderausstellung werden die Ergebnisse nun dorthin getragen, wo Weiterentwicklungen bereits laufen oder angestossen werden – damit aus Visionen tragfähige Projekte für eine widerstandsfähige, lebenswerte Hochrhein-Region werden.
Projektleitend durchgeführt wird die Sommerakademie 2025 von der OST – Ostschweizer Fachhochschule, Institut für Landschaft und Freiraum: Prof. Andrea Cejka und der FHNW, Institut Architektur: Dr. Andreas Nütten.
Auftraggeber sind die Kantone Aargau und Basel-Landschaft in Kooperation mit der Hochrheinkommission, dem Aggloprogramm Basel, der Internationalen Bodenseekonferenz und Interreg Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein, unterstützt von den Gemeinden: Rheinfelden (Baden), Rheinfelden, Möhlin, Kaiseraugst, Augst, Grenzach-Wyhlen, Pratteln, Muttenz und Birsfelden.