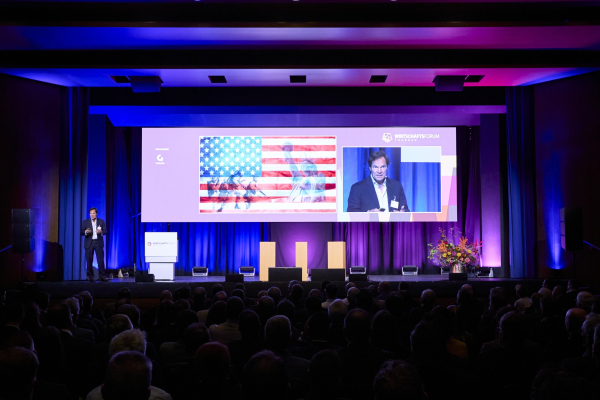HSG Impact Awards 2025: Smart Criminal Justice, Kreislaufwirtschaft und Konzernverantwortung

Text: PD/stz.
Insgesamt werden drei Auszeichnungen verliehen. Im Jahr 2025 gehen diese an das Projekt «Smart Criminal Justice» von Prof. Dr. Monika Simmler und Prof. Dr. Kuno Schedler, an das Forschungsprojekt «Circular Lab: Implementing the circular economy» von Dr. Fabian Takacs, Anna Burch, Prof. Dr. Karolin Frankenberger, Prof. Dr. Andrei Ciortea und Prof. Dr. Simon Mayer sowie an das Projekt «Tracing cobalt in fragmented supply chains» von Prof. Dr. Florian Wettstein, Dr. Isabel Ebert und Laura Neufeldt-Schoeller.
Die Jury, bestehend aus Praktikern und Universitätsangehörigen, bewertete Bewerbungen aus unterschiedlichsten Disziplinen der HSG-Forschung. Die Preise wurden im Rahmen des Festtages «Dies academicus» am Freitag, 9. Mai 2025, verliehen.
Forschung prägt Bundesgerichtsurteil zur Digitalisierung in der Strafverfolgung
Mit dem Forschungsprojekt «Smart Criminal Justice» hat die Universität St.Gallen einen bedeutenden Beitrag zur Regulierung moderner Technologien in der Strafverfolgung geleistet. Unter der Leitung von Prof. Dr. Monika Simmler (Strafrecht) und Prof. Dr. Kuno Schedler (Public Management) untersucht das Projekt seit 2019 den Einsatz intelligenter Technologien in der Polizeiarbeit und Strafrechtspflege – und stellt dabei die Balance zwischen Sicherheit und Grundrechtsschutz ins Zentrum.
Das Projekt fand im Herbst 2024 besondere Beachtung, als das Bundesgericht in einem wegweisenden Urteil zur automatisierten Fahrzeugfahndung, Datenanalyse und Gesichtserkennung gleich zwölfmal auf Publikationen des Projekts verwies. Es hob mehrere Bestimmungen des Luzerner Polizeigesetzes auf – unter anderem wegen unzureichender gesetzlicher Grundlagen für KI-Einsätze – und bekräftigte die Bedeutung der informationellen Selbstbestimmung.
Die Forschung zeigt: Auch scheinbar einfache algorithmische Systeme greifen tief in Grundrechte ein. «Smart Criminal Justice» macht diese Eingriffe sichtbar, schafft Transparenz in einem bislang intransparenten Bereich und fördert den gesellschaftlichen Diskurs. Die Erkenntnisse sind heute relevanter denn je – denn neue Technologien wie Deepfakes oder KI-gestützte Strafzumessungen werfen laufend neue rechtliche Fragen auf.
Circular Lab: Kreislaufwirtschaft als Schlüssel zur Zukunft
Das Circular Lab an der Universität St.Gallen zeigt, dass die Circular Economy (CE) weit mehr ist als ein Trend – sie ist eine existenzielle Notwendigkeit. Initiiert durch Dr. Fabian Takacs, Anna Burch und Prof. Dr. Karolin Frankenberger (IfB-HSG) sowie Prof. Dr. Simon Mayer und Prof. Dr. Andrei Ciortea (ICS-HSG), entwickelt das interdisziplinäre Lab innovative, praxisnahe Lösungen für die Transformation unserer Wirtschaft hin zu einem nachhaltigen Kreislaufsystem.
Ein Beispiel ist das gemeinsam mit dem Zürcher Kultlabel FREITAG lancierte Projekt «Circular Tarp», das Taschen aus gebrauchten LKW-Planen durch eine neue, vollständig recycelbare Monomaterial-Plane ersetzt – und so erstmals einen geschlossenen Materialkreislauf ermöglicht. Das Circular Lab begleitet dieses Projekt technisch, finanziell und konzeptionell – ein Paradebeispiel für funktionierende CE-Innovationen im industriellen Massstab.
Daneben zeigt das Lab mit der Refashion Collection, der Textilausstellung «Circle of Water», einem umfassenden Circular-KPI-System, dem praxisorientierten Buch «Circular Economy Navigator» (Hanser, August 2025) sowie einer empirischen KMU-Studie, wie sich CE ganz konkret umsetzen lässt.
Mit Unterstützung von EU und Bund (Fördervolumen: ca. 4 Mio. Franken) ist das Lab das grösste CE-Projekt an der HSG. Es vereint sechs Hochschulen und über 30 Unternehmen aus der DACH-Region, um zirkuläre Geschäftsmodelle, Ökosysteme und Technologien zu erforschen und umzusetzen.
Unternehmensverantwortung im Kongo
Wie lassen sich Kobalt-Lieferketten auf verantwortungsvolle Weise organisieren? Dies war die Ausgangsfrage des Forschungsprojekts «Tracing cobalt in fragmented supply chains» von Prof. Dr. Florian Wettstein, Dr. Isabel Ebert und Laura Neufeldt-Schoeller.
In Zusammenarbeit mit dem internationalen Anbieter von Zugangslösungen, dormakaba, deckte die daraus resultierende Studie des Instituts für Wirtschaftsethik (IWE-HSG) systemische Herausforderungen bei der Rückverfolgbarkeit sowie ethische Dilemmata im Zusammenhang mit Kobalt aus der Demokratischen Republik Kongo auf. Eine der wichtigsten Erkenntnisse war, dass die Vermeidung von Kobalt aus der DRK weder realistisch noch ethisch vertretbar ist – stattdessen sind sinnvolle Massnahmen vor Ort erforderlich.
Infolgedessen trat dormakaba im Jahr 2024 der Initiative «The Hub for Child Labour Prevention and Remediation» bei, die unter der Leitung von «Save the Children» und «The Center for Child Rights and Business» steht. Die Initiative trägt dazu bei, Kinder aus gefährlichen Bergbauverhältnissen zu befreien und Familien mit Bildung, Gesundheitsversorgung und nachhaltigen Einkommensalternativen zu unterstützen.
«Der grösste Erfolg des Projekts ist, dass das Unternehmen unsere Empfehlungen wirklich angenommen und mit deren Umsetzung begonnen hat. Darüber hinaus hat dormakaba weitere Unternehmen und andere Interessengruppen hinzugezogen, um die Wirkung seiner Massnahmen zu verstärken», so Prof. Dr. Florian Wettstein.