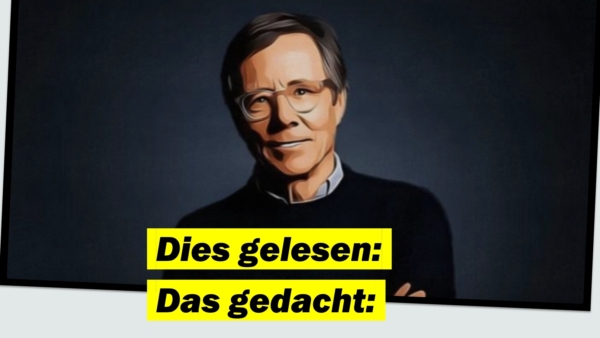Braucht die FDP eine gemeinsame Linie?
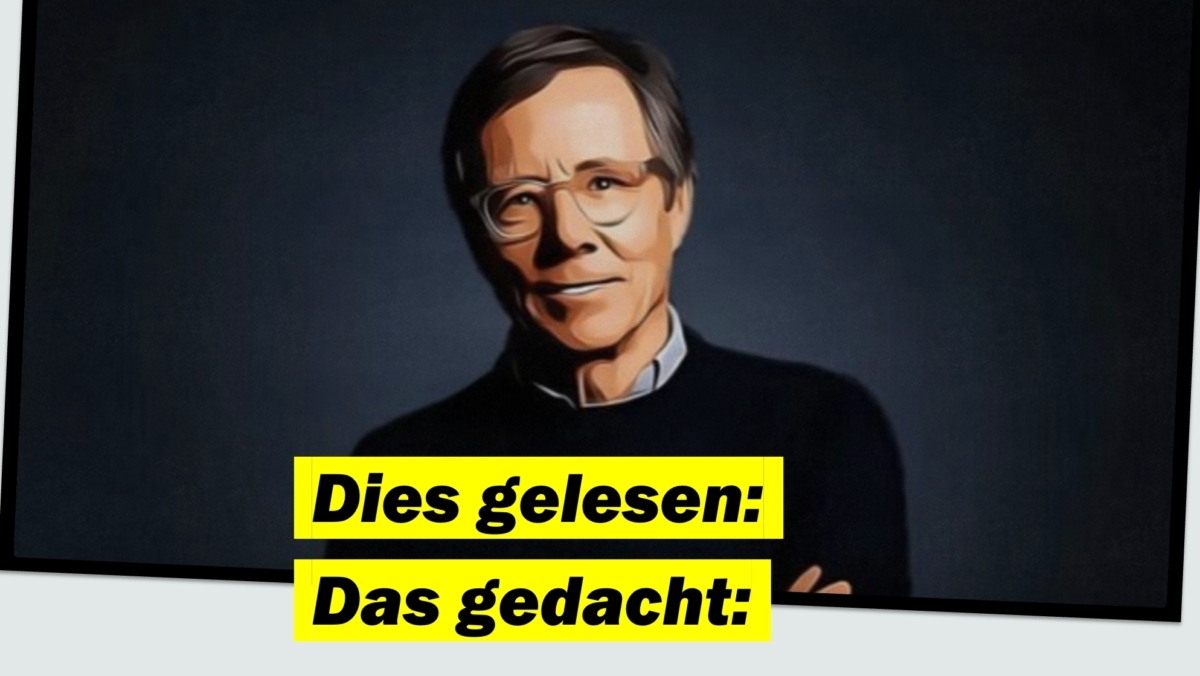
Text: Kurt Weigelt
Dies gelesen: «Die FDP steht vor einer Zerreissprobe: Die Europafrage rührt an einem alten Trauma.» (Quelle: tagblatt.ch, 3.5.2025)
Das gedacht: Die Sache ist nicht ganz einfach. Laut Medienberichten umfasst das Vertragspaket der Schweiz mit der EU rund 1500 Seiten. Da verliert man rasch einmal die Übersicht.
Dies weiss auch der Bundesrat. Deshalb wird alles unternommen, um die politische Auseinandersetzung bereits im Vorfeld der parlamentarischen Diskussion in die gewünschte Richtung zu lenken. Dazu gehörte, dass in einer ersten Phase nur ausgewählten Politikerinnen und Politiker eine privilegierte Einsicht in das Vertragswerk gewährt wurde.
Zu diesen Manövern gehört aber auch die Frage des Ständemehrs. Noch bevor das Volk und die Kantone - je nach politischer Agenda - die Bilateralen III, respektive das Rahmenabkommen 2.0 kennen, teilt uns der Bundesrat mit, dass die ganze Angelegenheit keinen Verfassungsrang hat.
Wirtschaftspolitiker vs. Staatspolitiker
Im Grunde genommen ist die Ausgangslage aber alles andere als kompliziert. Auch für die FDP. Es stehen sich zwei grundsätzliche Überzeugungen gegenüber:
Auf der einen Seite die Wirtschaftspolitiker. Für sie dreht sich fast alles um die Frage des Binnenmarktes. Aus ihrer Sicht führt mit Blick auf die Interessen des Wirtschaftsstandorts und der Unternehmen kein Weg an der dynamischen Übernahme von Gesetzen und Verordnungen der Europäischen Union und eine Unterstellung unter den Europäischen Gerichtshof vorbei.
Im Gegensatz dazu die Staatspolitiker. Sie gewichten die institutionellen Besonderheiten der Schweiz wie die direkte Demokratie, den Föderalismus oder das Milizsystem stärker als kurzfristige wirtschaftlichen Interessen. Nach ihrer Überzeugung ist ein von unten aufgebautes Gemeinwesen zukunftstauglicher als zentralverwaltete politische Systeme.
Kinder der Volksrechte
Es liegt in der Natur jeder politischen Auseinandersetzung, dass selbst Menschen mit einer vergleichbaren Werthaltung einen konkreten Sachverhalt unterschiedlich beurteilen. Eine Tatsache, die offensichtlich nicht ins Bild der veröffentlichten Meinung passt.
Unterschiedliche Meinungen werden nicht als Stärke, sondern als «Zerreissprobe» interpretiert. Der im Tagblatt-Artikel zitierte Politologe aus der Westschweiz ist denn auch der Überzeugung, dass es der FDP gelingen muss, «eine gemeinsame Linie zu finden».
Das ist Unsinn. Nach Erich Gruner sind die Schweizer Parteien Kinder der Volksrechte. Als solche widerspiegeln sie geradezu exemplarisch die unterschiedliche politische Entwicklung in den einzelnen Kantonen und den verschiedenen Landesteilen. Dazu gehörte und gehört in der FDP das Spannungsverhältnis zwischen der staatsgläubigeren Westschweiz und der staatskritischeren Deutschschweiz. Dieses Spannungsverhältnis ist kein Problem, keine Zerreissprobe. Ganz im Gegenteil.
Vielfalt in der Einheit
Der konstruktive Umgang mit unterschiedlichen sprachlichen, konfessionellen und kulturellen Traditionen sowie unterschiedlichen wirtschaftlichen Begebenheiten zeichnet den Sonderfall Schweiz aus. Im genossenschaftlichen Staatsverständnis geht es nicht um Einheitlichkeit, sondern um die in der Präambel der Bundesverfassung angesprochene Vielfalt in der Einheit.
Die alte Eidgenossenschaft funktionierte als Zusammenschluss von unterschiedlichen, aber gleichberechtigten Stadt- und Länderorten. Mit dem Föderalismus, der direkten Demokratie und dem Milizsystem gelang der modernen Schweiz eine zeitgemässe Weiterentwicklung des genossenschaftlichen Staatsverständnisses.
Dezentrale Grundordnung
Parteiensysteme sind immer das Abbild der politischen Kultur und der institutionellen Eigenarten einer Nation. Die politischen Parteien in der Schweiz sind von unten nach oben aufgebaut. Sie widerspiegeln unsere dezentrale Grundordnung und die Besonderheiten der direkten Demokratie.
Ganz anders die politischen Parteien beispielsweise in Deutschland. In einer repräsentativen Demokratie geht es immer um Regierung und Opposition, richtig oder falsch, schwarz oder weiss.
Was unter diesen Voraussetzungen zählt, ist die Parteidisziplin, der Gleichschritt, die Unterordnung unter die Parteiführung. Die Nichtwahl eines Kanzlerkandidaten im ersten Wahlgang löst Weltuntergangsstimmung aus. Für abweichende Meinungen gibt es keinen Platz. Gehorsam ist nicht nur des Bürgers, sondern auch des Parlamentariers erste Pflicht.
Auch interessant
Der Staat denkt und lenkt
Der Vergleich zwischen der geordneten Bundesratswahl vom vergangenen März und der aktuellen, von Gehässigkeiten und politischen Winkelzügen begleiteten Regierungsbildung in Deutschland zeigt beispielhaft den Unterschied zwischen dem genossenschaftlichen Staatsverständnis der Schweiz und dem autoritären Demokratieverständnis unserer Nachbarländer.
Eine Tatsache, die in der Schweiz von vielen Medienschaffenden, Wissenschaftlern, Bundesangestellten und Wirtschaftspolitikern nicht mehr verstanden wird. In ihrem Weltbild verlaufen politische Entscheidungsprozesse wie in der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten von oben nach unten. Der Staat denkt und lenkt. Die Macht konzentriert sich bei der Verwaltung und den Gerichten. Parlamente sind ein Störfaktor, von Volksentscheiden ganz zu schweigen.
Die Liberalen
Dass die Medien die Parolenfassung der FDP Schweiz zum Vertragspaket mit der EU als eine Art Endspiel darstellen werden, lässt nicht vermeiden. Der Schlagzeilen-Journalismus kennt lediglich Sieger und Verlierer.
Nur, die unterschiedlichen internen Positionen verschwinden mit dem Mehrheitsentscheid nicht. Dieser verpflichtet die Parteiführung, nicht aber die Parteibasis. Und das ist gut so.
Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt machen eine freiheitliche Gesellschaft aus. Nicht die Parteidisziplin. Dies gilt erst recht für eine politische Partei, die sich wie die FDP selbst als «Die Liberalen» definiert.