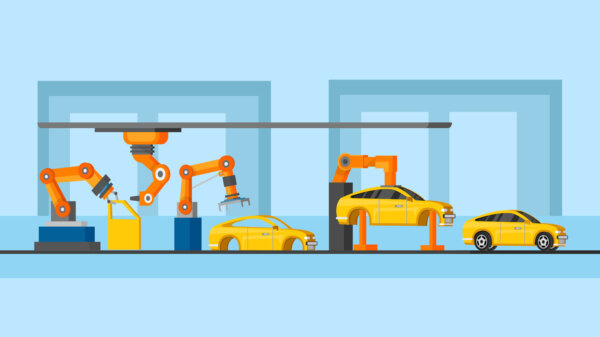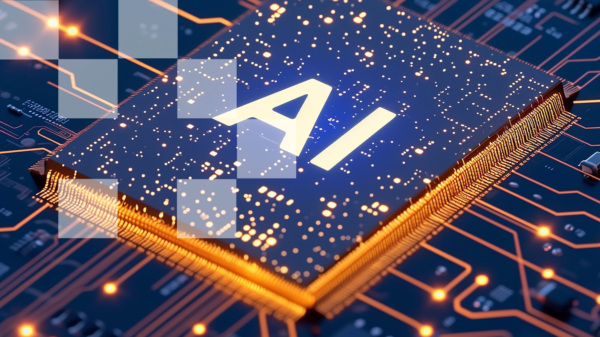Vom Wert des Liquiditätsmanagements

Marco Gehrig, nur gut ein Drittel der Schweizer KMU haben normalerweise einen Bankkredit oder einen Kreditrahmen. Wieso nur so wenige?
Viele KMU bevorzugen eine hohe Selbstfinanzierung. Es ist Teil ihrer Unternehmenspolitik, unabhängig von ihren Kapitalgebern zu sein und eigenständig Investitionsentscheidungen treffen zu können. Obwohl Fremdfinanzierung aus einer theoretischen Perspektive interessant ist, bevorzugen die Schweizer KMU eine unabhängige Finanzierungspolitik. Daher erstaunt es auch nicht, dass viele KMU über sehr hohe Geldflüsse aus Betriebstätigkeiten und ein striktes Kostenmanagement verfügen.
Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen sind in der Schweiz hingegen etablierter Bestandteil des Cash-Managements. Warum ist für KMU diese Finanzierungsform attraktiv?
Ein Vorteil liegt in den fehlenden Zinsen. Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten beruhen auf Vertrauen und Langfristigkeit – und diese werden selten verzinst. Daher liegt dieser Umstand auf der Hand: Besser eine offene Verbindlichkeit gegenüber einem Lieferanten als gegenüber einer Drittpartei, wo Zinskosten fällig sind.
Liquiditätsengpässe und restriktive Kreditbedingungen von Banken zwingen Unternehmen, eigene Verpflichtungen verspätet zu begleichen und Kredite von Lieferanten vermehrt als Liquiditätsquelle zu nutzen. Diese Entwicklungen führen unweigerlich zu Liquiditätsproblemen bei den Lieferanten. Wie kann der Kreislauf durchbrochen werden?
Die Lieferanten ihrerseits bevorzugen gegenüber ihren Zulieferern Lieferantenkredite als Finanzierungsquelle … Daher gilt die alte Finanzierungsweisheit für das Working Capital: Sammle früh das Geld bei den Kunden ein, kaufe günstig ein und zahle spät die Lieferantenrechnung. Es gibt hier wohl kein Maximum, mehr ein Optimum. Und es gilt auch, die Zahlungsbereitschaft mithilfe von kurzfristigen Bankkontokorrenten zu sichern. Und hier spielen die Kredit gebenden Banken eine wichtige Rolle im Wirtschaftskreislauf.
«Besser eine Verbindlichkeit gegenüber einem Lieferanten als gegenüber einer Drittpartei.»
Höhere Bestände an Forderungen aufgrund verspäteter Zahlungen belasten die Liquidität und erfordern eine kompensatorische Finanzierung bei Banken oder Lieferanten. Die erhöhte Kapitalbindung führt zu tieferen Margen und zu höheren Refinanzierungskosten. Warum werden Forderungen so, sagen wir, lasch gehandhabt?
Dies mag zahlreiche Gründe haben. Aber zentral scheint mir, dass man Kunden als Kunden ansieht und ihnen möglichst viel Flexibilität bieten will. Sprich: möglichst kundenflexible Zahlungsbedingungen. Und dies kann im Extremfall zu Liquiditätsproblemen und Debitorenverlusten führen. Aber ist es vermutungsweise auch so, dass das Liquiditätsmanagement auch in den letzten Jahren nicht das Top-Thema war, da die Wirtschaft eine starke Wachstumsphase gehabt hat. Seit Corona sind wir wohl jetzt in einer Krisenphase, die das Thema wieder aktuelle werden lässt.
Um den Unternehmenswert hochzuhalten, soll die Dauer der Kapitalbindung möglichst tief gehalten werden. Die damit verbundene geringe Liquidität hat aber zur Folge, dass Unternehmen gerade in Krisen gefährlichen Belastungen ausgesetzt werden. Was empfehlen Sie?
In einer solchen Phase gilt es, kühlen Kopf zu bewahren und sich auf die wichtigen Themen zu fokussieren. Die Frage stellt sich, worauf achten die Kredit gebenden Banken? Es ist die Verschuldungskapazität, die wiederum im Wesentlichen durch die Geldzuflüsse gespiesen wird. Daher gilt der Ratschlag: Die Liquidität in diesen Zeiten wöchentlich planen und sich fragen, welche Geldzuflüsse und -abflüsse zu erwarten sind. Dies verlangt das neue Aktienrecht indirekt ohnehin, das am 1. Januar 2023 in Kraft tritt.
Grosszügigkeit bei Zahlungseintreibung und einem allenfalls erforderlichen Betreibungsverfahren führt zu zusätzlichen Verlusten. Gleichzeitig erhöht sie die Kundenbindung. Was ist wichtiger?
Die Kundenbindung. Privatrechtliche Lösungsfindungen sind zu bevorzugen und entsprechen unserem Verständnis, Lösungen bilateral zu suchen. Betreibungen sollten nur im letzten Fall möglich sein und wenn man davon ausgehen kann, dass eine Zusammenarbeit keinen Sinn mehr macht.
Auch interessant
«Liquiditätsmanagement war in den letzten Jahren kein Top-Thema.»
Wie wichtig ist die Früherkennung von Marktentwicklungen und deren Risiken, also ein eigentliches Frühwarnsystem?
Ich beurteile dies als sehr zentral. Kostenmanagement und verlässliche Daten sind das eine, eine profunde Branchenkenntnis und Erfahrung das andere. Erfolgreiche Unternehmer tun dies alltäglich.
Was sind für Sie persönlich die wichtigsten Punkte, die ein KMU in seinem Kreditmanagement beachten soll?
Die Kredit gebenden Banken legen viel Wert auf die Verschuldungskapazität. Wenn man Banken versteht und die Banken die Kunden verstehen, müsste die Formel eigentlich wie folgt lauten: Eine aktive Finanzplanung ist unabdingbar, um die Steuerung und Planung eines Unternehmens darlegen zu können. Es mag eine «wertlose» Arbeit zu sein scheinen, aber eine aktive Auseinandersetzung mit einem Finanzplan kann einen besseren Blick in die Zukunft geben – und bessere Beurteilungen und Ratings bei der Bank.
Und soll dies eher inhouse gemacht oder outgesourct werden?
KMU haben oft begrenzte Ressourcen. Der Aufbau kann mit externer Hilfe erfolgen und nützlich sein. Entscheidungen müssen am Ende intern vollzogen werden. Aber externer Rat kann manchmal neue Einblicke geben. Es ist wohl eine individuelle Frage, die jedes Unternehmen für sich entscheiden muss.