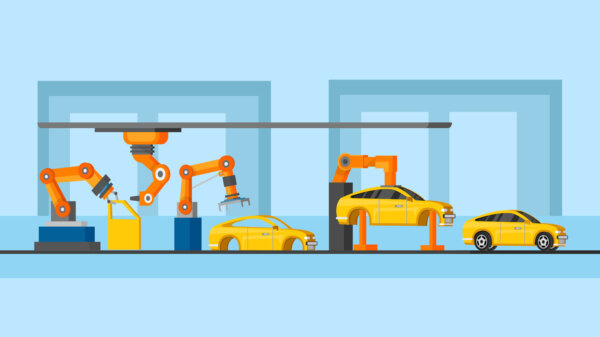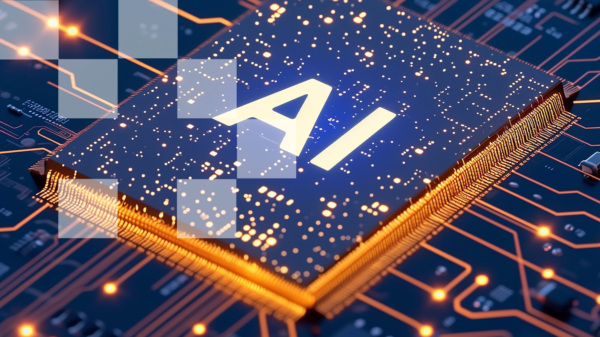Der Zwang, stets an Neuem zu tüfteln

Alexander Fust, können Sie den Begriff «Hidden Champion» etwas schärfen?
Ein «Champion» muss nicht gerade ein Weltmarktführer sein, ich würde das breiter definieren: Sprechen wir doch von einem namhaften Player in einem bestimmten Markt. So gesehen haben wir recht viele Firmen in der Ostschweiz, die diesem Kriterium entsprechen.
Sind diese Firmen «hidden»?
Das ist eine Frage der Wahrnehmung. Bei Unternehmen, die Business-to-Business-Geschäftsbeziehungen pflegen, also vor allem mit anderen Unternehmen arbeiten, ist es oft so. Viele dieser Firmen sind nicht börsennotiert, weshalb sie auch keine Geschäftszahlen publizieren und nicht auf dem Radar professioneller Anleger sind. B2B-Firmen, die nicht für Endkunden produzieren, kennt man tatsächlich kaum, wenn man mit ihrem Markt nichts zu tun hat. Solche Unternehmen sind meistens in Nischenmärkten tätig und hoch spezialisiert. Wer selbst auch in diesem Markt tätig ist, kennt diese Firmen aber sehr gut.
Versteckt in der Nische kann es einem Unternehmen also ganz gut gehen.
Früher war es okay, wenn mich kaum jemand kannte – ausser meinen Kunden natürlich. Heute aber, im Zeichen des Fachkräftemangels, ist «hidden» definitiv eine schlechte Eigenschaft. Eine Firma, die man nicht kennt, wird es schwer haben, an gute Leute zu kommen. Darum wollen Unternehmen heute nicht mehr versteckt sein.
«Schaut her, ich bin ein Champion!»?
In der Ostschweiz sind wir eher zurückhaltender, wir klopfen uns weniger selbst auf die Schulter und streichen heraus, wie gut wir sind – im Gegensatz zum Beispiel zu Amerikanern, die ich kenne, die ein anderes Selbstverständnis haben. Wir haben viel Potenzial in der Ostschweiz und ich meinte auch einen guten Menschenschlag, aber wir könnten uns vielleicht noch besser verkaufen.
Auch die bestehenden Mitarbeiter würden es schätzen, dass sie bei einem «Champion» arbeiten.
Die guten Ostschweizer Unternehmen zeichnen sich durch ihre hervorragenden Mitarbeiter aus. Leute, die oft ein sehr grosses technisches und fachliches Wissen sowie grosse Erfahrung auf ihrem Gebiet haben. Gerade sehr spezialisierte Unternehmen können selten Leute rekrutieren, die aufgrund ihrer allgemeinen Ausbildung das nötige Wissen bereits mitbringen. Sie haben die Grundlagen, das spezialisierte Know-how erlernen diese Leute on the Job. Als Arbeitgeber muss ich meine Hausaufgaben machen, damit ich gute neue Leute rekrutieren kann, aber auch, um meine wertvollen Mitarbeiter halten zu können.
Kennen die Ostschweizer KMU ihre Hausaufgaben als Arbeitgeber?
Wir geben zusammen mit der OBT eine Schriftenreihe heraus, Studien und Leitfäden zu verschiedenen Themen. Seit wir vor zwei Jahren den Leitfaden zur Arbeitgeberattraktivität für KMU herausgegeben haben, wird der in hoher Zahl heruntergeladen. Es lohnt sich, ins Thema Employer Branding zu investieren. Wir sehen in praktisch jeder Branche Firmen, die keine Probleme haben, gute Leute anzuziehen. Aber eben auch etliche Firmen, die damit Mühe haben. Es ist anzunehmen, dass sich dieser Trend noch weiter verstärken wird, wenn die Generation der Babyboomer pensioniert wird und die Konjunktur gut bleibt. Viele Firmen haben Massnahmen umgesetzt, um attraktiver für Mitarbeiter zu werden. Es braucht heute mehr Anstrengungen, damit Firmen die richtigen Leute finden.
Selbst für die guten Firmen wird der Fachkräftemangel ein limitierender Faktor bei Wachstum bleiben.
Der Fachkräftemangel kann tatsächlich Wachstum behindern, deshalb investieren auch viele Firmen noch mehr in die Automatisierung und Prozessoptimierung sowie in die angesprochene Verbesserung der Arbeitgeberattraktivität.
Sie forschen und lehren am KMU-Institut der HSG. Sind Sie ein Hort für Hidden Champions?
Wenn wir davon ausgehen, dass solche Hidden Champions oft KMU sind: Ja. In den meisten Fällen sind es Familienunternehmen – von ganz unterschiedlicher Grösse. Es können in selteneren Fällen «K», also solche mit bis zu 50 Mitarbeitern sein, aber auch «M» mit bis zu 250 Angestellten und grösseren Familienunternehmen mit mehreren Tausend Mitarbeitern.
Und stark spezialisiert?
Sie haben einen bestimmten Fokus, und sie machen etwas besser als andere.
Mit diesem Know-how bedienen sie kleine Nischen – dafür weltweit?
Unter den Hidden Champions nach meinem Verständnis gibt es auch Dienstleister, aber in aller Regel reden wir von produzierenden Betrieben. Solche Unternehmen exportieren oft. Das ist für kleinere Firmen eine Herausforderung, sie müssen sich ein globales Vertriebsnetz aufbauen, um ihre Produkte oder teilweise ganze Systeme zu verkaufen. Wenn sie zu klein sind, um dafür eigene Tochterfirmen aufzubauen, können sie das auch mit Vertriebspartnern tun.
Ist das die grösste Herausforderung für Hidden Champions?
Die vermutlich grösste Herausforderung ist, sich nicht auf dem Erfolg auszuruhen. Erfolg kann träge machen. In meiner Nische muss ich meinen Kunden stets einen Mehrwert bieten können. Das zwingt ein Unternehmen, stets an Neuem zu tüfteln. Champions, ob hidden oder nicht, müssen aus einem Überlebenstrieb heraus kundenorientiert und innovativ sein.
Ohne Innovation wird auch ein Champion ersetzt?
Ja. Wenn ich ein Produkt nicht weiterentwickle, kommt eines Tages ein Me-too-Produkt, das ein Konkurrent günstiger anbietet, oder jemand bietet eine leicht verbesserte Lösung an. Dann kann es ungemütlich werden. Die Dynamik in der heutigen Zeit ist brutal. Manchmal kann man mit einem bestehenden Produkt auch mehr Nischen abdecken und effizienter in der Herstellung werden. Aber auch dann wird es schwierig, wenn man es verpasst, besser zu werden, Innovation zu betreiben, den nächsten Schritt zu machen.
Auch interessant
Innovation gibt es nicht gratis.
Deshalb müssen die Unternehmen eine vernünftige Marge erwirtschaften. Wenn die Marge zu klein wird, fehlt das Geld, um in Innovation investieren zu können.
Mit einer besseren Marge könnte man auch ein hübscheres Quartalsergebnis erzielen.
Darum sind viele Champions Familienunternehmen: Sie denken nicht in Quartalsergebnissen, sie denken in Generationen. Auch wenn die Rendite einmal nicht hoch ist: Man schaut nach vorn und investiert in die Leute, in die Technologien.
Haben Familienunternehmen wirklich eine längerfristige Strategie?
Ich weiss von Firmen, die gerade während Covid sagten: «Wir müssen jetzt investieren. Wir glauben an unsere Leute, wir zeigen denen: Dein Arbeitsplatz ist sicher.» Diese Unternehmen investierten in die Zukunft, obwohl sie weniger zu tun hatten, Aufträge ausblieben. Sie setzten darauf, dass sie besser aufgestellt sind, wenn die Geschichte vorbei ist. Viele Firmen haben während der Pandemie auch baulich in den Standort Ostschweiz investiert. Das ist ein unternehmerischer Entscheid, ein Statement. Das Unternehmen geht ein gewisses Risiko ein, weil es glaubt, dass dies der richtige Weg ist.
«Champions müssen aus einem Überlebenstrieb heraus kundenorientiert und innovativ sein.»
Haben Hidden Champions spezielle Unternehmertypen an der Spitze?
Das kann man vermutlich nicht verallgemeinern. Aber Familienunternehmer denken zwangsläufig ganzheitlicher, weil ihr Name verpflichtet. Sie kennen ihre Kunden, ihre Lieferanten, ihre Mitarbeiter. Bei grösseren Unternehmen ist das oft weniger der Fall. Mitglieder der Geschäftsleitung bringen nicht diese Breite an Wissen mit – und sie stehen auch nicht mit ihrem Namen im Firmenlogo.
Bei Familienunternehmen gibt es also eine höhere Identifikation?
Es gibt oft eine authentische Firmenkultur, die Unternehmen haben Ziele und stehen dafür ein, sie sind sehr glaubwürdig, sie denken langfristig. Das sind übrigens alles Punkte, die auch die eigenen Mitarbeiter schätzen.
Wie bringt man das Bewusstsein, dass es stete Innovation braucht, in die Köpfe der Belegschaft?
Gerade habe ich von einem Unternehmer gehört, der plakativ eine Pseudo-Krise inszeniert. Damit will er seinen Leuten sagen: Wir können so weiter wirtschaften wie heute, dann haben wir in fünf Jahren ein Problem. Wir sind jetzt erfolgreich, aber es ist nicht gottgegeben, dass das so bleibt. Also fangen wir jetzt an zu überlegen, wie wir uns verbessern können.
Was eine Verbesserung ist, beurteilt letztlich der Kunde.
Darum ist es von Vorteil, wenn man schon in der Entwicklung mit dem Kunden etwas zusammen machen kann. Früher hatten sich Technologie-Unternehmen nicht gerne in die Karten blicken lassen, auch von guten Kunden nicht. Ich denke, das hat sich spätestens seit dem Millennium geändert. Vor zehn Jahren habe ich in meiner Doktorarbeit, untersucht, wie Unternehmen auf neue Geschäftsmodelle gekommen sind. Im B2B-Bereich war es fast immer aufgrund von Kundenanfragen; oft haben Kunde und Lieferant dann miteinander etwas entwickelt. Teilweise geschah dies auf Risiko des Lieferanten, teilweise auf geteiltes Risiko. Es gibt einen klaren Trend in den vergangenen Jahrzehnten weg von der Produkte-Orientierung hin zur Kunden-Orientierung. Man spricht von «Customer Value», das ist eine andere Denkweise.
Welche Vorteile hat ein Lieferant dadurch? Wird mein Kunde abhängiger von mir?
Vordergründiges Ziel ist, dass mein Kunde wettbewerbsfähiger wird. Aber klar, wenn der Kunde durch mein Produkt einen Vorteil hat, dann ziehe ich auch einen Vorteil daraus.
Ein Kunde, der die Zahl seiner Lieferanten reduziert, gibt ihnen mehr Macht.
Die Lieferengpässe der jüngsten Jahre zeigten: Wenn mein Lieferant seine Materialien nicht bekommt, hänge ich auch. Da hätte ich vielleicht lieber mehrere Lieferanten. Trotzdem gibt es viel benutzte Ansätze aus dem Lean Management: Ein Unternehmen pflegt eine intensivere Zusammenarbeit mit weniger Lieferanten. Dadurch können gemeinsame Prozessoptimierungen erreicht und Verschwendung reduziert werden.
Wenn ein Kunde expandiert, muss man dann als Lieferant notgedrungen mitwachsen?
Wenn ich nicht mitziehe, zwinge ich den Kunden, einen Ersatz für die Expansion zu suchen – ein Ersatz, der mich allenfalls in Zukunft ganz rausdrücken könnte. Solche Fragen sind nicht trivial. Ein Unternehmer weiss nicht, was in fünf Jahren passiert, aber er muss jetzt Entscheide treffen – und investieren, in Anlagen, Räumlichkeiten, neue Leute, denn ein Know-how-Aufbau geht nicht so schnell.
Ein Unternehmen braucht finanzielle Reserven für den Fall, dass der Kunde erfolgreich ist.
Eine Wachstumsstrategie muss man finanzieren können. Um die nötige Liquidität zu schaffen, formuliert die Firma Anforderungen an ihre Cashflow-Marge. Ich kenne etliche Firmen, die seit vielen Jahren erfolgreich unterwegs sind und sehr wenig Fremdkapital in den Büchern haben, manchmal nur als Hypothek oder als Kreditoren. Sie finanzieren das Wachstum oft mit eigenen Mitteln. Andere Firmen arbeiten mit Banken und allenfalls mit Bürgschaftsgenossenschaften zusammen, um das Wachstum über Kredite zu finanzieren.
Wäre es eine Option, neue Aktionäre an Bord zu holen?
Ein Familienunternehmen würde eine andere Firma, wenn es relevante Anteile rausgibt. Plötzlich entscheidet noch jemand mit – das wollen die wenigsten. Möglich wäre je nach Zielsetzung, ein neues Geschäftsfeld partnerschaftlich zu erschliessen, dafür also ein Joint Venture zu gründen, ohne den Besitz des Stammhauses zu verwässern.
Dr. Alexander Fust ist Leiter Transfer & Fördergefässe am KMU-Institut der Universität St.Gallen (HSG), wo er auch Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung ist. Der Direktor des Fördervereins KMU-HSG ist auch ständiger Dozent an der HSG.
Text: Philipp Landmark
Bild: Thomas Hary