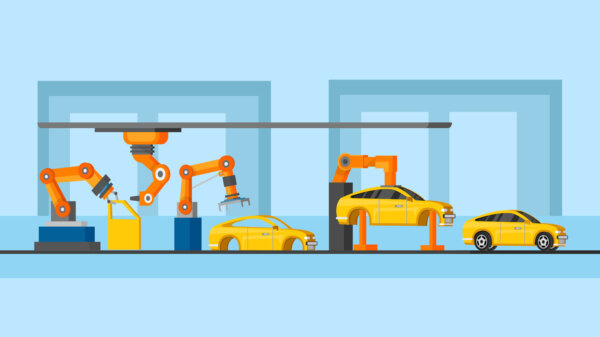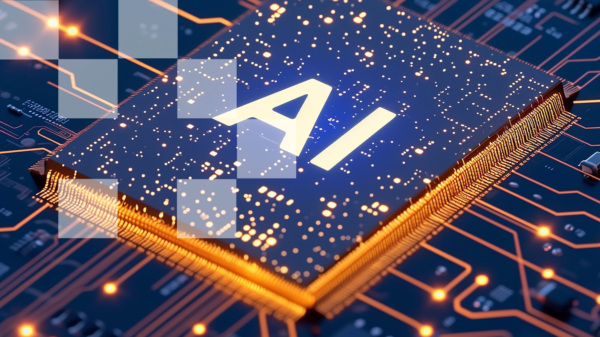Rechtliche Tücken in der Arbeitswelt

Rechtsanwalt Hansruedi Wyss ist Partner der Anwaltskanzlei Bratschi AG und Spezialist für privates Arbeitsrecht und öffentliches Personalrecht – «ein breites Feld, das bildet die Lebenswirklichkeit ab», sagt er. Rechtsfragen drehen sich beispielsweise um die Themen, ob Kündigungen missbräuchlich sind, zuletzt ging es häufig auch um Kurzarbeitsentschädigungen oder Homeoffice, «das hat sich inzwischen aber eingespielt.» Im Zentrum der Tätigkeit des Juristen steht das Beratungsgeschäft – Personalreglemente zeitgemäss überarbeiten, Rechtsfälle vorbeugen, Begleitung bei GAV-Verhandlungen.
Für den Leader zeigt Hansruedi Wyss auf, wie einige gängige Klippen des Arbeitsrechts am besten zu umschiffen sind.
«Private Aktivitäten der Mitarbeiter dürfen nicht im Personaldossier dokumentiert werden.»
Stellenausschreibung
Es gibt keine gesetzlichen Vorgaben zur Stellenausschreibung als solche, «somit auch keine Pflicht, eine Stelle geschlechtsneutral auszuschreiben», sagt Hansruedi Wyss. Ein Freipass sei dies jedoch nicht: «Es gibt ein Aber», mahnt Wyss, «im Gleichstellungsgesetz gibt es ein Geschlechterdiskriminierungsverbot.» Dieses beinhaltet zwar auch keine rechtliche Pflicht, Stellen geschlechtsneutral auszuschreiben. Wenn jedoch eine Position nur männlich oder nur weiblich ausgeschrieben wird, könnte das in einer rechtlichen Auseinandersetzung als ein Indiz für eine Geschlechterdiskriminierung herangezogen werden.
Neben den gesetzlichen Vorgaben gibt auch eine Best Practice, die sich stetig wandelt. Da gehört es heute schon fast selbstverständlich dazu, Stellen geschlechtsneutral auszuschreiben. «Es gibt gewisse gesellschaftliche Tendenzen, die von Unternehmen, die sich auf der Höhe der Zeit zeigen wollen, aufgenommen werden», erklärt Hansruedi Wyss. Aktuell sehe man den Trend, Stellen in verschiedenen Varianten als «männlich / weiblich / divers» auszuschreiben.
Darf man also nie eine Stelle geschlechtsspezifisch ausschreiben? «Eine Ungleichbehandlung ist dann zulässig, wenn es einen sachlichen Grund dafür gibt», betont Wyss. «Fehlt dieser, kann es in die Diskriminierung kippen.»
Liegt bei einer Nicht-Einstellung ein diskriminierender Grund vor – wenn beispielsweise jemand keine Frauen einstellt, weil sie schwanger werden könnten –, besteht gestützt auf das Gleichstellungsgesetz von 1995 zwar kein Anspruch auf nachträgliche Einstellung, aber ein Entschädigungsanspruch. Bewerber haben nach dem Gleichstellungsgesetz einen Anspruch auf eine schriftliche Begründung der Ablehnung. Wenn sie eine Diskriminierung geltend machen wollen, können sie eine solche Begründung verlangen. Ein kluger Arbeitgeber werde selbstverständlich niemanden diskriminieren und auch keine diskriminierende Begründung abgeben, «es wäre nicht besonders clever, das Geschlecht als Grund anzugeben», sagt Hansruedi Wyss. Darum werden sich Bewerber in der Regel mit einer unverfänglichen Absage im Sinn von «eine andere Person hat besser ins Profil gepasst» begnügen müssen.
Nicht immer wird der Rat, dass man sich nicht aufs Geschlecht oder sonstige Merkmale einer Person versteigen sollte, befolgt. Die schriftliche Absage «Wir stellen keine Leute ein, die Kopftücher tragen» zog einen Gerichtsfall nach sich. Die Begründung wurde nicht als geschlechterdiskriminierend, jedoch als persönlichkeitsverletzend beurteilt und hatte eine Genugtuungsleistung zur Folge. «Der Fall verdeutlicht, dass persönlichkeitsverletzende Absagen rechtliche Konsequenzen haben», hält Hansruedi Wyss fest.
Bewerbungsunterlagen
Als Bewerbungsunterlagen noch dicke Papierbündel waren, gehörte es zum guten Ton, die Dossiers von nicht berücksichtigten Bewerbern zurückzuschicken. Gelegentlich hat sich eine weniger gut organisierte Firma das Porto fürs Zurückschicken auch mal gespart. Heute sind digitale Dossiers üblich – die dann auf ewig beim Arbeitgeber gespeichert bleiben? «Wenn ein Bewerbungsverfahren ergebnislos verlaufen ist, gibt es keinen Grund, die Unterlagen aufzubewahren. So wie früher physische Unterlagen zurückgeschickt wurden, wären diese Daten heute zu vernichten», hält Hansruedi Wyss klar fest.
Ein Dossier zu behalten, weil es interessant für allfällige nächste Vakanz sein könnte, ist denkbar, aber: «In solchen Fällen ist es erforderlich, das mit dem Bewerber abzusprechen.»
Die Unterlagen müssen allerdings nicht sofort zurückgeschickt oder gelöscht werden, man kann sie behalten, solange der Arbeitgeber noch ein berechtigtes Interesse daran hat. Steht beispielsweise der Vorwurf einer diskriminierenden Nicht-Anstellung im Raum steht, sieht das Gesetz vor, dass dies innert drei Monaten geltend gemacht werden müsste. Während dieser Frist kann man als Arbeitgeber Unterlagen im Zusammenhang mit der Bewerbung behalten, um Gegenbeweis führen zu können. Danach gilt der Grundsatz, dass die Unterlagen vernichten werden müssen, wenn kein berechtigtes Interesse mehr vorliegt. Streng ausgelegt müsste man auch Übersichtslisten mit den Namen der eingegangenen Bewerbungen vernichten. Anders verhält es sich, wenn man bei Online-Bewerbungstools die meistens ausführlichen Disclaimer und Nutzungsbedingungen akzeptiert. «Da sind oft auch Löschungsmodalitäten vermerkt, zumindest der Account eines Bewerbers bleibt oft noch für eine bestimmte Zeit aktiv», sagt Wyss.
Auch interessant
Personalakte
Ein häufiger Zankapfel im Arbeitsleben ist die Personalakte. Dabei gibt es gar keine rechtliche Definition, was ein Personaldossier ist, wie Hansruedi Wyss betont: «Es gibt nur eine materielle Definition, aber es ist nicht per se klar, was alles dazu gehört.»
Im Obligationenrecht ist festgehalten, dass ein Arbeitgeber Daten bearbeiten darf, wenn diese mit der Eignung des Arbeitnehmers für das Arbeitsverhältnis in einem Zusammenhang stehen und mit der Entstehung sowie mit der Durchführung des Arbeitsverhältnisses zu tun haben, also auch Bewerbungsunterlagen. Informationen, die nicht für die Entstehung oder Durchführung des Arbeitsvertrags erforderlich sind, dürfen nicht bearbeitet werden: «Private Aktivitäten der Mitarbeiter dürfen beispielsweise grundsätzlich nicht im Personaldossier dokumentiert werden.»
Hansruedi Wyss erläutert dies an einem aktuellen Beispiel: Wenn ein Angestellter an einer Demonstration von Corona-Skeptikern teilnimmt, gehört das nicht ins Personaldossier. Wenn dieser Mitarbeiter aber für diese Demo Werbung im Betrieb macht und es deswegen eine Auseinandersetzung mit Vorgesetzten gab, darf man dies dokumentieren. «Da sind wir dann wieder beim Weisungsrecht des Arbeitgebers: Man kann den Angestellten politische Aktivitäten am Arbeitsplatz grundsätzlich untersagen.»
«Was jemand privat macht, geht den Arbeitgeber grundsätzlich nichts an.»
Nicht geregelt ist, wo und bei wem eine Personalakte aufbewahrt werden muss. Hingegen ist klar, dass die Datenbearbeitung transparent sein muss, «das ist ein Grundsatz aus dem Datenschutzgesetz», erklärt Wyss. Ebenso klar müsste sein, dass Mitarbeiter Anspruch auf Einsicht ins Personaldossier haben. Doch da gibt es immer wieder Konflikte: «Ich habe schon eigenartige Sachen erlebt im Zusammenhang mit Mitarbeiterdaten, manchmal wird ein grosses Geheimnis um Personaldossiers gemacht.»
Das gilt nicht nur für die Angestellten selbst: «Ich habe auch kein Verständnis dafür, wenn man versucht, Personaldaten vor Vorgesetzten geheim zu halten, dafür gibt es keinen rechtlichen Grund.» Für eine neue Chefin eines Mitarbeiters sei es relevant zu wissen, dass diese Person vor einem Jahr verwarnt wurde oder wie gut die letzte Mitarbeiterbeurteilung war. «Diese Daten müssen zugänglich sein, sonst können Vorgesetzte ihren Job nicht richtig machen und die Organisation schiesst sich aus falsch verstandenem Datenschutz ins eigene Knie», hält Wyss fest.
Um nicht dem Anspruch auf Einsichtnahme zu unterliegen, werden manchmal gewisse Dokumente gar nicht erst im offiziellen Personaldossier abgelegt. Wenn das HR «persönliche Handnotizen» anlege, sei dies «sicher nicht nach den Regeln der Kunst», bemerkt Hansruedi Wyss. Wo verläuft da die Grenze? «Ein Protokoll eines Mitarbeitergesprächs gehört sicher in die Akte», sagt Wyss, «persönliche Notizen und Gedächtnisstützen sind von Einsichtsanspruch nicht erfasst.» Es ist aber nicht auszuschliessen, dass ein Gericht im Einzelfall in dieser Frage weiter gehen würde, denn grundsätzlich sei der Einsichtsanspruch der Mitarbeiter sehr umfassend. Bei der Dateneinsicht gebe es zudem die Möglichkeit, gewisse Angaben zu schwärzen oder zu anonymisieren, wenn sie schutzwürdige Interessen von Drittpersonen betreffen, «man muss diese Dokumente herausgeben, aber wenn die Interessen Dritter überwiegen, eben nicht vollständig.»
Zeugnis
Arbeitszeugnisse sind oft nichtssagend beliebig, weil sich kein Arbeitgeber gerne die Finger verbrennt – und deshalb versucht, möglichst pragmatisch dem Grundsatz nachzuleben, wonach ein Zeugnis «wahr und wohlwollend» zu sein habe. Das weiss auch Hansruedi Wyss: «Das kann ein Dilemma sein.»
Arbeitgeber sollten sich deshalb in eine Position bringen, in der sie Zeugnis-Angaben objektivieren können. So sollten Mitarbeiterbeurteilungen als Basis für das Zeugnis herangezogen werden können. «Man hat keinen Anspruch auf ein Superzeugnis», erläutert Hansruedi Wyss, «es gibt aber einen gewissen Standard, von dem man ausgehen kann.» Wenn der Arbeitgeber hinter diesen gut klingenden Standard-Formulierungen zurückbleiben will, muss er nachweisen können, wo allfällige Mängel der Leistung oder des Verhaltens des Mitarbeiters sind. «Idealerweise kann man das mit Mitarbeiterbeurteilungen belegen», sagt Wyss. In einem solchen Fall lässt sich auch ein betont unbegeistertes Zeugnis vertreten. Wenn umgekehrt ein Angestellter mehr will als den üblichen guten Standard, dann muss er beweisen, warum dies angebracht ist.
Ein Zeugnis muss stets die ganze Periode eines Arbeitsverhältnisses abdecken. Wenn am Schluss eines längeren, einwandfreien Arbeitsverhältnisses noch etwas Negatives vorfällt, «dann sollte man das nicht aufplustern». Ebenso rät Wyss, gerade bei mit Zeugnis-Tools erstellten Zeugnissen aus HR-Abteilungen darauf zu achten, dass Textbausteine und Floskeln, die mit den konkreten Leistungen und dem gezeigten Verhalten nichts zu tun haben, gelöscht oder ersetzt werden.
Wenn sich also beim Verfassen eines Zeugnisses die beiden Gebote «wahr» und «wohlwollend» widersprechen, dann muss die nicht-wohlwollende Wahrheit belegbar sein. Umgekehrt darf man unbequeme Wahrheiten nicht einfach unter den Tisch fallen lassen, wie Wyss anhand eines Beispiels darlegt: «Es gibt einen Gerichtsfall, in dem eine frühere Arbeitgeberin gegenüber der neuen Arbeitgeberin haftbar gemacht wurde, weil sie ein gutes Zeugnis ausgestellt hatte, obwohl der Mitarbeiter veruntreut hatte.» Der Mann hat Geld abgezweigt und wurde fristlos entlassen, das sah man dem Zeugnis aber nicht an. Am neuen Arbeitsort hat er prompt wieder Geld in die eigene Tasche fliessen lassen. «Das führte zu einem Schadensersatzanspruch der neuen Arbeitgeberin gegenüber der alten Arbeitgeberin.»
Sollte ein Mitarbeiter delinquiert haben, muss man dies einem Zeugnis also ansehen. «Da gibt es aber ein praktisches Problem: Im Zeitpunkt der Trennung ist der Delinquent noch nicht rechtskräftig verurteilt», sagt Wyss. Man könne aber von einer «erheblichen Pflichtverletzung» oder einem «mutmasslich strafbaren Verhalten» schreiben.
Wyss verweist auf einen Fall von Stalking und Belästigung unter Angestellten: «Da war man recht explizit im Zeugnis und begründete die Trennung mit ‹Fehlverhalten gegenüber einer anderen Person›.» Der Fall habe bedrohliche Ausmasse angenommen und sei strafrechtlich relevant gewesen, «das führte dann auch zu einer Verurteilung».
Besonders gravierende Vorfälle haben also ihren Niederschlag im Zeugnis zu finden. Klar ist: Ein Arbeitnehmer wird sich nicht mit einem solchen Zeugnis bewerben, sondern eine Arbeitsbestätigung verlangen. In dieser ist die Zeitspanne des Arbeitsverhältnisses vermerkt, es steht aber nichts zu Leistung und Verhalten. «Es spricht ja auch Bände, wenn jemand längere Zeit irgendwo angestellt war und dann kein Zeugnis vorlegt», sagt Wyss.
Auch interessant
«Einen Facebook-Account dürfte man im Zuge des Rekrutierungsprozesses eigentlich nicht anschauen.»
Referenzen
In überschaubaren Branchen kann es verlockend sein, sich informell bei Bekannten über eine bestimmte sich bewerbende Person zu erkundigen. Keine gute Idee, wie der Arbeitsrechtler findet: «Unautorisierte Referenzauskünfte einzuholen, ist unzulässig.» Auch Referenzen beim früheren Arbeitgeber darf man nur mit Zustimmung eines Bewerbers einholen. «Oft schicken Bewerber eine Liste von Referenzen mit, das kann man als Zustimmung deuten.»
Wenn ein Arbeitgeber als Referenz angegeben wird und angefragt wird, muss sich die Auskunft am Zeugnis orientieren. «Darum sollte das Zeugnis eben schon das wiedergeben, was war, und das sollte man idealerweise in einer Referenzauskunft bestätigen können. Wenn man diesen Korridor verlässt, kreiert man rechtliche Risiken», warnt Hansruedi Wyss. Gegebenenfalls solle man sich als Auskunftsperson eher bedeckt halten. Wenn man auf die übliche Frage «Würden Sie diese Person wieder einstellen?» nicht Ja sagen könne, dann könne man sich rausreden im Sinn von «die Stellenprofile haben sich verändert».
Ein anderer Fall sei es, wenn jemand fristlos entlassen wurde. «Das lässt sich dem Zeugnis entnehmen, darum kann man auch sagen: ‹Den stellen wir nicht mehr an›.» Bei einem normalen Trennungsprozess hingegen solle man sehr vorsichtig sein.
Auch der naheliegende Blick auf Social-Media-Accounts von Bewerbern ist eine Grauzone. Ein LinkedIn- oder ein Xing-Profil anzuschauen sei legitim, sagt Hansruedi Wyss – dort fänden sich ja ohnehin meist ähnliche Informationen wie in einem CV und diese Profile dienten unter anderem auch dazu, sich auf dem Arbeitsmarkt zu zeigen. «Aber einen Facebook- oder Instagram-Account dürfte man im Zuge des Rekrutierungsprozesses eigentlich nicht anschauen», betont Wyss, weil man sich da in der Sphäre des Privaten bewege. «Gemacht wird es wahrscheinlich trotzdem. Und die praktische Frage ist schon: Stört es jemanden, der sein ganzes Privatleben auf Instagram ausbreitet, dass dies auch ein potenzieller Arbeitgeber sieht?» Aus rechtlicher Sicht dürfen aber nur Daten bearbeitet werden, die im Zusammenhang mit der Eignung der Kandidaten für das Arbeitsverhältnis stehen.
Weisungen
Wie weit kann ein Arbeitgeber unter speziellen Voraussetzung Einschränkungen in der Ausschreibung vornehmen? Darf man verlangen, dass der Sekretär einer Umweltpartei aufs Autofahren verzichtet, kann man einer Rechtsanwältin vorschreiben, dass sie sich elegant kleidet? Ein Arbeitgeber kann nur Weisungen erteilen, die relevant sind für die Arbeitssphäre, erklärt Hansruedi Wyss. «Was jemand privat macht, geht den Arbeitgeber grundsätzlich mal nichts an.» Eine Umweltpartei allerdings würde als sogenannter Tendenzbetrieb eingestuft, ein Job auf deren Geschäftsstelle ist mit einer gewissen Gedankenwelt verbunden. Deshalb könne der Arbeitgeber hier Weisungen erteilen, die etwas weiter gehen, sagt Wyss: «Das Verhalten eines Parteisekretärs in der Öffentlichkeit wird wahrgenommen, das sollte grundsätzlich passen.» Wenn der Parteisekretär von Montag bis Freitag mit dem Velo ins Büro fährt, sich am Wochenende aber im Ferrari-Fanclub engagiert und seine Ausfahrten auf Facebook und Instagram postet, würde das wohl Diskussionen auslösen. «Man könnte wohl nicht so weit gehen und sagen, dass der Stelleninhaber in der Freizeit gar nicht Auto fahren darf», sagt Wyss, «aber man könnte ihm zumindest empfehlen, sich ein anderes Hobby zu suchen oder das diskreter auszuüben.»
Dass sich eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt businesslike kleiden soll, sei vom Weisungsrecht des Arbeitgebers abgedeckt, «dieses kann auch Kleidervorschriften umfassen, soweit diese sachlich gerechtfertigt sind», erklärt Hansruedi Wyss, «Der Look einer Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwalts sollte zum Image der Anwaltskanzlei passen.»
Gleicher Lohn
Seit jeher wird in der Arbeitswelt um faire Entschädigung der Arbeit gerungen. Und fast so lange ist die Lohndiskrepanz zwischen Mann und Frau ein Thema. Der einfache Grundsatz «gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit» lässt sich offenbar nicht so einfach umsetzen. In der Schweiz gibt es mit der Lohngleichheitsanalysepflicht ein relativ neues Instrument, damit müssen nun Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern überprüfen, ob das Gebot der Lohngleichheit erfüllt ist. «Wenn dies nicht der Fall ist, bezieht sich das Ergebnis nicht unbedingt auf ein spezifisches Individuum», erläutert Hansruedi Wyss. Eine individuelle Klägerin könnte das Ergebnis aber in einem Prozess als Indiz herbeiziehen. Solche Anhaltspunkte sind notwendig, denn Angestellte können nicht auf Verdacht hin vom Arbeitgeber verlangen, dass ihnen Lohndaten offengelegt werden. Erst in einem Gerichtsprozess kann man Beweisanträge stellen und verlangen, die Arbeitgeberin sei zu verpflichten, die Lohndaten von Personen, die die gleiche Arbeit machen, offen zu legen.
Wer den Eindruck hat, beim Lohn benachteiligt zu werden, kann aber nicht aus dem hohlen Bauch heraus eine Klage hängig machen, «zumindest nicht mit Aussicht auf Erfolg». Als Arbeitnehmer muss man konkrete Anhaltspunkte haben, dass es vermutlich eine Diskriminierung gibt.
Ein Kläger muss vor Gericht glaubhaft machen können, dass es geschlechterbedingte Lohndiskriminierung gibt. Wenn dies gelingt, gibt es eine Beweislastumkehr: «Dann muss die Arbeitgeberin beweisen, dass diese Löhne nicht diskriminierend sind.» Allfällige Lohndifferenzen müssten im Prozess begründet werden.
Wenn eine Klage gutgeheissen wird, kann dies für einen Arbeitgeber teuer werden: Aus dem Gleichstellungsgesetz können Ansprüche auf diskriminierungsfreien Lohn auf fünf Jahre zurück geltend gemacht werden. «Lohndiskriminierung ist ein Risiko, dass man sicher nicht bewusst in Kauf nehmen darf», rät Hansruedi Wyss.
In vielen Bereichen gibt es inzwischen auch bei Ausschreibungsverfahren explizite Auflagen in dieser Richtung. Wer sich um einen Auftrag der öffentlichen Hand bemüht, muss nachweisen, dass man diskriminierungsfreie Löhne zahlt, um überhaupt zum Handkuss zu kommen.
Homeoffice
Durch die Pandemie bekam die Arbeit im Homeoffice einen völlig neuen Stellenwert. Die teilweise Homeoffice-Pflicht im letzten Jahr kommt aus der Covid-Sondergesetzgebung, die viele Folge-Fragen aufwarf. «Das ist eine Lehre aus Corona: Homeoffice ist gut, aber man sollte das auch regeln, um Missverständnisse und Diskussionen zu verhindern», sagt Hansruedi Wyss. Etwa Fragen nach einer Entschädigung für den privaten Arbeitsplatz. Klar ist nur: Wenn in der Firma für einen Mitarbeiter gar kein Arbeitsplatz mehr zur Verfügung gestellt wird, dann steht ihm gemäss einem Bundesgerichtsentscheid eine Entschädigung für seine private Büroinfrastruktur zu.
Einen generellen Anspruch auf Homeoffice hat der Gesetzgeber nicht vorgesehen. In besonderen Situationen könne dies aber angezeigt sein, Hansruedi Wyss verweist dazu auf ein spezielles Urteil des Bundesverwaltungsgerichts: Eine beim Bundesamt für Informatik und Telekommunikation beschäftigte Person mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung hatte eine medizinisch Bestätigung, dass sie leidet, wenn sie in Grossraumbüro arbeitet. Das Amt trennte sich deshalb von dieser Person, die Richter waren jedoch der Ansicht, dass die Arbeitgeberin im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht der Person zumindest versuchsweise die Arbeit im Homeoffice hätte gestatten müssen.
«Homeoffice ist gut, aber man sollte das auch regeln, um Missverständnisse und Diskussionen zu verhindern.»
Im Normalfall kann eine Arbeitgeberein im Rahmen des Weisungsrechts bestimmen, wie und in welcher Infrastruktur eine Arbeit gemacht werden soll. Wenn also Angestellte aus Einzelbüros in Grossraumbüros zügeln sollen, haben sie dagegen keine rechtliche Handhabe.
Impfung
Im Zuge der Pandemie kam auch die Frage auf, ob ein Arbeitgeber voraussetzen darf, dass sich die Arbeitnehmer impfen lassen. «Da liegt die Latte sehr, sehr hoch», sagt Hansruedi Wyss, «das ist ein Eingriff in die physische Integrität. Das ist im Arbeitsverhältnis nicht vorgesehen.» Auch eine obligatorische Impfung gebe es nicht, auch wenn eine solche im Epidemiegesetz als Möglichkeit vorgesehen sei.
Gerade unter dem Personal im Gesundheitswesen werde die Corona-Impfung kontrovers diskutiert, Spitäler wollten eine Impflicht bewusst nicht stipulieren – auch Leuten im Gesundheitswesen wolle man die Wahlfreiheit lassen. «Wenn aber eine Impfpflicht im Gesundheitswesen nicht ernsthaft diskutiert wird, dann sehe ich kaum noch Felder, wo das legitim sein könnte», hält Wyss fest. Voraussetzung für eine Impfpflicht müsste sein, dass die Arbeit anders nicht gemacht werden könnte. Lässt sich ein Mitarbeiter auch dann nicht impfen, wäre vor einer Kündigung eine Ersatzbeschäftigung zu prüfen.
Etwas anderes sieht die Situation bei Corona-Tests in Firmen aus: «Da ist die Schwelle tiefer», erklärt Wyss, «Die Teilnahme an Tests, die in ein betriebliches Schutzkonzept integriert sind, könnte man unter Umständen verlangen, um beispielsweise einen potenziellen Superspreader-Event zu vermeiden. Die Arbeitgeberin darf den Test aber nicht gegen den Willen von Angestellten durchführen».
Text: Philipp Landmark
Bild: Thomas Hary