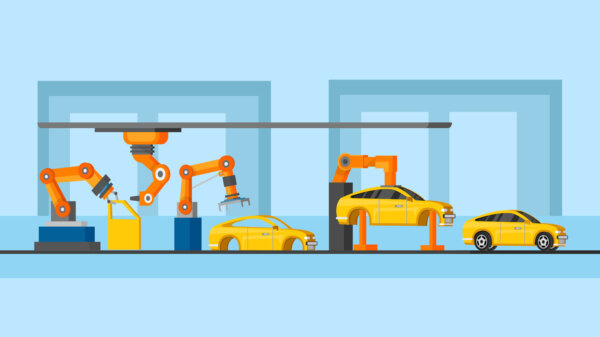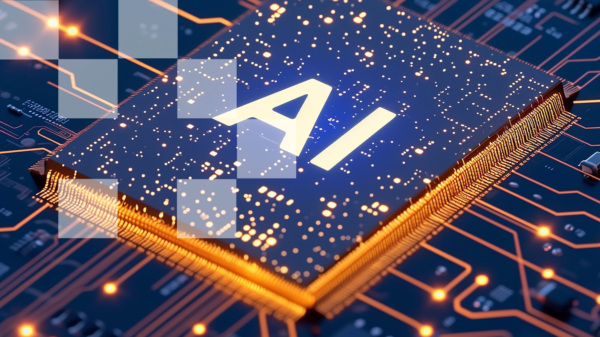Energie à discrétion

Text: Philipp Landmark
Manchmal kann Frustration eine positive Emotion sein. 2010 wurde das Geothermie-Projekt in Basel definitiv eingestellt, nachdem bei Probebohrungen 2006 Erdstösse bis zu einer Stärke von 3,5 auf der Richter-Skala ausgelöst wurden. Im Thurgau ärgerte sich eine Handvoll an Energiefragen interessierte Leute, dass dieses Projekt «vermasselt» wurde und man sich eine solche Chance entgehen liesse. Die Thurgauer schimpften aber nicht nur, sie wollen es besser machen und die Chance packen: Im Mai 2011 gründeten sie in Weinfelden den Verein Geothermie Thurgau.
Ein Gründungsmitglied des Vereins ist Andreas Koch, der heute auch als dessen Geschäftsführer fungiert. Das Aus in Basel führt Andreas Koch primär auf die mediale Berichterstattung über «Erdbeben» zurück: «Wir waren schockiert, als wir sahen, dass in der Öffentlichkeit absolutes Unverständnis herrschte.»
Die seismischen Aktivitäten in Basel oder auch bei der Geothermie-Bohrung in St.Gallen entsprachen gefühlt einer Erschütterung, «wie wenn früher das Panzerbataillon 26 durch den Thurgau fuhr.» Das Geschirr im Schrank klirre zwar, aber ein «echtes» Erdbeben mit katastrophalen Folgen war das nicht, betont Andreas Koch. «Geothermie ist in der Regel unproblematisch und wird tausendfach erfolgreich genutzt auf der Welt.»
Allen erzählen, wie das funktioniert
Die Vereinsmitglieder waren sich einig, dass ein künftiges Geothermie-Projekt in der Schweiz aufgrund der diffusen Ängste in der Bevölkerung nicht mehr Top-Down realisiert werden könne. «Uns war klar, jetzt geht es nur noch Bottom-up», sagt Andreas Koch, «also müssen wir allen im Thurgau erzählen, wie das funktioniert und welche Chance sich darin verbirgt.» Somit hatte und hat der Verein Geothermie Thurgau vorrangig einen Auftrag: Kommunikation.
Der Verein ist mit einem grossen, prominent besetzen Vorstand breit abgestützt und hat im Ausschuss viel Know-how an Bord. Die Mitgliederzahl wuchs rasch an, heute ist der Verein Geothermie Thurgau gleich gross wie der nationale Verband für Geothermie. «Unser Ziel war stets, Mitglieder zu gewinnen und jedem einzelnen zu sagen: ‹vor Geothermie brauchst Du keine Angst zu haben!›» Zu diesem Zweck kuratierte der Verein Geothermie Thurgau 2014 sogar eine Sonderschau an der WEGA und belegte eine ganze Halle. Die Aufklärungsmission in Sachen Geothermie hat inzwischen offiziellen Charakter, der Verein Geothermie Thurgau hat einen Leistungsauftrag des kantonalen Amtes für Energie bekommen, um über diese erneuerbare Energie und die Technologie dahinter zu informieren.
«Wir kennen den Untergrund in groben Zügen.»
Fehlende Informationen
Eine wesentliche Information allerdings fehlt: Der Beleg, dass der Thurgauer Untergrund ein wirtschaftlich vernünftiges Anzapfen der Erdwärme tatsächlich zulässt. Natürlich treibt die Geothermie-Promotoren die Grundannahme, dass eine Nutzung möglich ist, an. Über den Thurgauer Untergrund gibt es heute aber mehr Annahmen und Vermutungen als konkrete Daten. «Wir kennen den Untergrund in groben Zügen, wir wissen, welche Schichten in welcher Tiefe sind», sagt Andreas Koch. Es gibt auch schon ein Thurgauer Nutzungskonzept für die tiefe Geothermie, darin wurde, basierend auf Wissen über den Untergrund im süddeutschen Raum und auf Hinweisen aus Bohrungen der Nagra in Benken sowie Trüllikon und Marthalen, antizipiert, wie es im Thurgauer Untergrund aussehen dürfte.
Für einen potenziellen Investor ist dieses Wissen zu vage, das Risiko, bei einer Bohrung eine Überraschung zu erleben, ist zu gross. «Wir haben zu wenig Kenntnis vom Untergrund, als dass ein Konsortium von Projektanten hierherkäme», ist sich Andreas Koch bewusst, «das ist ein wesentlicher Grund für das Projekt, das wir gestartet haben.» Ein Projekt, mit dem das fehlende Wissen erschlossen werden soll.
Kapital von der TKB und vom Bund
Der Börsengang der Thurgauer Kantonalbank verlieh der Geothermie dann Auftrieb: 127 Millionen Franken standen dem Kanton als «Chancenpaket» für aussergewöhnliche Projekte zur Verfügung, im Jahr 2020 wurden aus dem ganzen Kanton Ideen eingereicht. «Auch wir haben versucht, die Finanzierung für ein Projekt zu gewinnen», sagt Andreas Koch. «TEnU 2030» heisst das Vorhaben, das Kürzel steht für Tiefenenergie aus dem Untergrund, Ziel ist, Grundlagendaten erarbeiten: «Bis etwa 2035 wollen wir eine dreidimensionale Karte haben, die so genau wie möglich aussagt, in welcher Tiefe welche Schicht liegt. Auch die Chance, ob diese Schicht viel Wasser führt oder keines, und wie hoch die Temperaturen sind, wollen wir erkunden.»
Dieses künftige Wissen will der Verein Geothermie Thurgau nicht monopolisieren, im Gegenteil, «das sind dann öffentliche Daten, die jeder haben kann, sie gehören der Thurgauer Bevölkerung», betont Andreas Koch. 2023 stimmte die Thurgauer Bevölkerung der Verwendung der TKB-Millionen deutlich zu. Als ein grosses Projekt wurde auch TEnU 2030 mit 20 Millionen Franken berücksichtigt. Durch diese Thurgauer Eigenleistung kann das Projekt auch auf entsprechende Bundessubventionen in Höhe von 60 Prozent der Projektkosten hoffen, also weitere 30 Millionen Franken. Mit diesen 50 Millionen Franken sollen nun in drei Projektphasen der Thurgauer Untergrund genauer untersucht und bis in etwa zehn Jahren alle notwendigen Informationen für eine nachhaltige geothermische Nutzung des Untergrunds erhoben und aufbereitet werden. Für diese Aufgaben wurde eine eigene Gesellschaft, die Geothermie Thurgau AG, gegründet (siehe auch nachfolgenden Artikel).
Die neue Gesellschaft wird alle operativen Aufgaben managen und auch die Aufträge an Dritte vergeben. Dafür kann sie tranchenweise das dafür vorgesehene Geld beim Kanton und beim Bund abrufen. «Das Beantragen der jeweiligen Mittel ist immer meilensteinabhängig», erklärt Andreas Koch, «das ist ein komplizierter Papiertiger.» Darum hat es in der neuen Gesellschaft Leute, die nicht nur die Geologie verstehen, sondern auch die komplexen Mechanismen der Finanzierung kennen: Vereinsmitglied Bernd Frieg, der als Delegierter des Verwaltungsrates die Geothermie Thurgau AG führt, hat 30 Jahre lang für die Nagra Felduntersuchungen und Bohrungen durchgeführt.
Abgesehen von Bernd Frieg gibt es keine personellen Überschneidungen bei Verein und AG, die neue Gesellschaft soll ihre Aufgabe unabhängig erfüllen können. Alleiniger Aktionär der Geothermie Thurgau AG ist aber der Verein Geothermie Thurgau, «der Regierungsrat hat explizit gewünscht, dass die AG keine Publikumsgesellschaft wird, sondern wir die Aktien halten», sagt Andreas Koch. Wenn die Geothermie Thurgau AG 2035 ihren Auftrag erfüllt hat und die Finanzierung der Grundlagenforschung aufgebraucht wurde, wird die Gesellschaft liquidiert.
Auch interessant
Kosten werden sinken
Wenn alles wie erhofft verläuft, sind bis dann im Kanton Thurgau mehrere Standorte identifiziert worden, die sich für eine Nutzung der Geothermie eignen würden, und mit einer, allenfalls zwei Probebohrungen wurden die Messresultate bestätigt. Idealerweise stehen dann Investoren bereit, die eine Anlage realisieren wollen. «Weder der Verein noch die AG werden selbst ein Kraftwerk betreiben», betont Andreas Koch, «wir möchten potenziellen Investoren den roten Teppich ausrollen.»
Die Kosten für ein kleineres Geothermie-Kraftwerk dürften anfangs im Bereich zwischen 60 und 100 Millionen Franken liegen, wobei auch hier mit Subventionen des Bundes gerechnet werden darf. Das aktuelle Tiefengeothermie-Pilotprojekt in Haute-Sorne (JU) wird stark subventioniert, «die Kurve muss dann einmal in den wirtschaftlichen Bereich kommen», sagt Andreas Koch, «die Erfahrungen zeigen auch, dass mit einer starken Degression der Kosten zu rechnen ist.» In den USA werden in Utah etliche Geothermie-Kraftwerke erstellt, auch im Raum München laufen aufgrund günstiger Voraussetzungen viele Geothermie-Anlagen.
Andreas Koch setzt grosse Hoffnungen auf die Schweizer Pilotanlage im Jura als Proof of Concept für die petrothermale Geothermie. «Ich bin überzeugt: Wenn das funktioniert, dann gehen überall Türen auf.» In der Schweiz gibt es heute kaum einschlägige Technologie. Bohrausrüstungen und Fachleute müssen jeweils aus dem Ausland geholt werden. Wenn künftig Geothermie systematisch genutzt würde, könnte sich auch in der Schweiz eine entsprechende Industrie entwickeln. «Wenn die Technologie sich durchsetzt, wird sich die Zulieferindustrie entwickeln, das könnte einen Boom auslösen», ist Andreas Koch überzeugt. Auch die Wissenschaft würde sich verstärkt dem Thema annehmen, «da werden dann Bachelor-, Master- oder Doktorarbeiten geschrieben, im Thurgau wird praktische Geologie betrieben.»
«Technisch ist es machbar, jetzt müssen wir das noch wirtschaftlich hinbekommen.»
Wem gehört der Boden?
Die absehbare Nutzung des Untergrunds wirft in einem ordentlich-geregelten Land wie der Schweiz natürlich Fragen auf: Wem gehört der Boden unter einer Parzelle, unter einem Haus? Der Verein Geothermie Thurgau stiess eine Regelung solcher Fragen an, 2016 trat im Kanton Thurgau das Gesetz über die Nutzung des Untergrunds in Kraft, das als Grundsatz festhielt: «Die Hoheit über den Untergrund, einschliesslich der Bodenschätze, und sämtliche damit verbundenen Nutzungs- und Verfügungsrechte stehen dem Kanton zu.» Diese Nutzungsrechte am Untergrund kann der Kanton gemäss dem Gesetz selbst ausüben «oder sie an Dritte übertragen».
In Deutschland sind solche Fragen seit den Zeiten des Bergbaus geregelt, in der Schweiz fehlten solche gesetzlichen Grundlagen vielerorts. Wenn der Kanton Thurgau bald seinen Untergrund besser kennenlernt, dann werden neben der Geothermie auch andere Themen diskutiert, etwa die CO2-Sequestrierung, also das Abscheiden und Speichern von CO2 in geeigneten Schichten im Untergrund. Das oberste Ziel der nun gestarteten Untersuchungen ist aber, aus Erdwärme Strom zu produzieren. «Technisch ist es machbar, jetzt müssen wir das noch wirtschaftlich hinbekommen», sagt Andreas Koch, «das läuft immer, wir hätten Energie à discrétion, ohne dass etwas verschmutzt und/oder aufgebraucht wird.»
Zwei Technologien
Bei der Nutzung der Geothermie wird grob zwischen zwei Technologien unterschieden. In der hydrothermalen Geothermie wird eine wasserführende Schicht gesucht, wie es sie etwa unter St.Gallen in rund 4,5 Kilometern Tiefe gibt. Der Gradient, der Temperaturzuwachs in der Tiefe, beläuft sich in der Regel auf drei Grad pro hundert Meter, in ca 4,0 Kilometern hat das Wasser eine Temperatur von 150 Grad Celsius. Damit kann dieses Wasser genutzt werden, um über eine Dampfturbine Strom zu erzeugen. Danach kann das immer noch warme Wasser genutzt werden, um ein Fernwärmenetz zu speisen – darum sollte eine Geothermie-Anlage möglichst nahe an potenziellen Wärme-Verbrauchern liegen. In der Schweiz geht man heute davon aus, dass nur eine kombinierte Anlage mit Stromproduktion und anschliessender Wärmeproduktion ökonomisch sinnvoll betrieben werden kann.
Beim Thurgauer Bodensee-Ufer im Bereich Kreuzlingen liegt dieselbe wasserführende Schicht deutlich höher als in St.Gallen, das Wasser ist deshalb nur zwischen 60 und 80 Grad heiss. Für eine Stromproduktion ist das zu wenig, in Schlattingen werden mit dieser Wärme aber Treibhäuser beheizt, was jährlich über eine halbe Million Liter Heizöl einspart.
Bei der petrothermalen Geothermie wird nicht eine wasserführende Schicht angebohrt, sondern Wasser über eine Bohrung in die Tiefe geführt, erwärmt, und über eine zweite Bohrung wieder heraufgeholt. Damit das Wasser in der Tiefe zirkulieren kann, wird ein künstlicher Wärmetauscher erzeugt, indem der Fels mit Wasser stimuliert wird, bis er aufbricht, und sich ein «Netzwerk» entwickelt. Auch bei dieser Technologie kann das heisse Wasser zuerst auf eine Dampfturbine geleitet und dann für ein Fernwärmenetz verwendet werden.
Text: Philipp Landmark
Bild: Marlies Beeler-Thurnheer, zVg